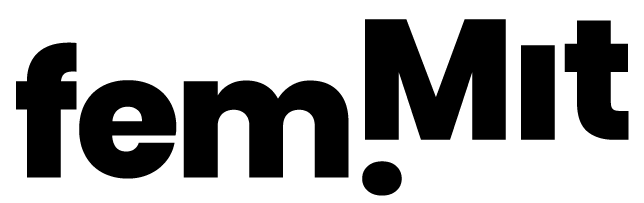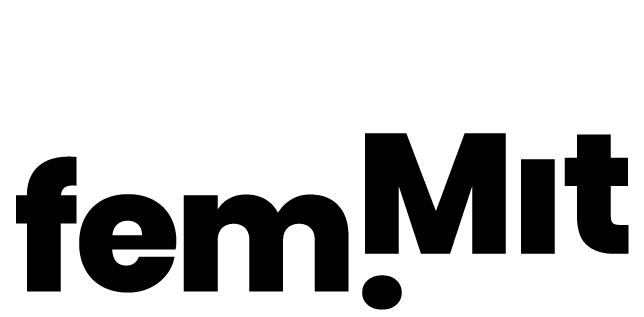In der Krise geht Mann ins Home-Office
von Robert Franken
Nach wie vor sind Frauen für die Care-Arbeit zuständig. Damit aus der Krise kein Rückschritt wird, müssen jetzt die Männer handeln.
Wirkliche Geschlechtergerechtigkeit ist weiterhin eher Wunsch als Realität. Die Corona-Krise schärft dafür noch einmal den Blick. Zunächst fällt auf, dass es in der Betrachtung der Auswirkungen der Krise auf das Geschlechterverhältnis eine Art „Meta-Whataboutism“ zu geben scheint. Aus zahllosen Diskussionen kannte man bereits den (i. d. R. männlichen) Einwand, wonach Männer das eigentlich benachteiligte Geschlecht seien, weil etwa ihre Selbstmordrate höher und ihre Lebenserwartung niedriger sei als bei den Frauen. So gut wie nie haben solche Beiträge übrigens tatsächlich das Wohl von Männern zum Ziel. Statt dessen wollen sie die Zerstörung der Diskussion erreichen.
Der Gender Care Gap wird offensichtlich
Bei Corona verhält es sich nun ganz ähnlich. Es häufen sich Hinweise in den einschlägigen Threads, nach denen die virusbedingte Sterblichkeit von Männern deutlich höher sei als die von Frauen. Und deshalb sei es angezeigt, die Männer anstelle der Frauen in den Blick zu nehmen. Doch ist es auch hier kaum die Sorge um die männliche Gesundheit, die zu derlei Intervention motiviert. Vielen Trollen und Maskulisten geht es auch hier fast ausschließlich um die Unterbrechung und Störung des feministischen Diskurses.
Dem müssen wir entgegenwirken, damit die Reflexe der Antifeministen keinen Schaden bei denjenigen anrichten, die grundsätzlich offen sind für Themen wie Chancengleichheit oder Vielfalt. Denn es besteht zweifellos – und vielleicht mehr denn je – dringender Handlungsbedarf. Trotz einiger Erfolge kann man nämlich durchaus der Meinung sein, dass das Glas in Sachen Gleichberechtigung aktuell eher halb leer ist. Dabei wirkt die Corona-Situation wie ein Brennglas. Asymmetrische Geschlechterverhältnisse treten in Zeiten der Pandemie noch deutlicher zutage als in normalen Zeiten.
Schon in Vorkrisenzeiten erledigten Frauen den Großteil der Care-Arbeit. Der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung bezifferte den Care Gap mit durchschnittlich 52,4 Prozent.
Der Gender Care Gap, also der Unterschied in der Übernahme von Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern, wird im Zuge von COVID-19 überdeutlich sichtbar und erlebbar. Schon in Vorkrisenzeiten erledigten Frauen den Großteil der Care-Arbeit. Der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung bezifferte den Care Gap mit durchschnittlich 52,4 Prozent. Sobald mindestens ein Kind im Haushalt lebt, steigt er auf 83,3 Prozent. Das zeigt, dass es in unseren Köpfen nach wie vor die Mütter sind, die wir für zuständig erklären, wenn es um Haushalt und Kinderbetreuung geht. In dem Moment, in dem sich Paare (hier sei mir der heteronormative Kontext einmal verziehen) entscheiden müssen, wer zu Hause bleibt, schlägt außerdem eine weitere Lücke ins Kontor.
Frauen verdienen laut Gender Pay Gap durchschnittlich 20 Prozent weniger als Männer. Kommt eine Krisensituation hinzu, geht der Mann ins (Home) Office, die Frau an den Herd. Was populistisch überspitzt klingt, hat einen einfachen Hintergrund: 67 Prozent des letzten Gehalts im Falle von Kurzarbeitergeld ist bereits ein Einschnitt, der viele Existenzen in Bedrängnis bringt. Die sehr häufig geringeren Einkünfte von Frauen sind in diesem Fall ein noch erheblich größeres Problem. Denn wenn die Berechnungsgrundlage für geminderte Lohnleistungen auch noch das (niedrigere) weibliche Einkommen ist, dann können oder wollen sich das viele Paare und Familien nicht leisten.

Männer haben die Macht für Veränderungen
Ein paar weitere Zahlen zeigen, wie prekär die Situation für viele Frauen ist. Von den Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren haben gerade einmal 10 Prozent ein Nettoeinkommen von 2 000 Euro oder mehr im Monat. Von den verheirateten Frauen in dieser Altersspanne haben 19 Prozent gar kein eigenes Einkommen, 63 Prozent verdienen weniger als 1 000 Euro im Monat. Und nur 39 Prozent sind überhaupt erwerbstätig – bei den Männern sind es 88 Prozent. Corona verschärft diese Problematik zusätzlich, aber systemische und strukturelle Bedingungen, sind ursächlich für bestimmte Zustände und Verhaltensmuster.
In den bereits angesprochenen Systemen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben Männer überdurchschnittlich viel Macht und Einkommen. Sie sind es deshalb auch, die Veränderung initiieren können – und müssen. Viele Männer erleben momentan vielleicht erstmals hautnah, was es heißt, sich vollumfänglich zu kümmern bzw. kümmern zu müssen. Viele bekommen endlich mit, wie hoch der Aufwand in Sachen Haushalt und Kindererziehung tatsächlich ist. Frauen wissen das längst. Hier könnte Corona durchaus ein Katalysator sein, zumindest für ein bestimmtes Bewusstsein. Die Krise könnte etwas schaffen, was zum Beispiel Elternzeit oder der feministische Diskurs nicht flächendeckend hinbekommen haben: Alltagserleben ohne Filter. Wenn wir die Pandemie als Chance verstehen wollen, dann dadurch, dass sehr viele Männer die Belastungen des Familienalltags vollumfänglich erleben. Wer als Mann und/oder Vater jetzt noch nicht begriffen hat, wie anspruchsvoll und zehrend Care-Arbeit sein kann, der wird es vermutlich nie verstehen.
Bewusstsein ist die eine Sache, Handeln der nötige nächste Schritt. Männer müssen Erziehungsverantwortung aktiv einfordern. Sie müssen ihr Selbstverständnis hinterfragen: Helfe ich im Haushalt? Oder ist es mein Haushalt? Muss sich alles meinem Erwerbs-Job unterordnen? Oder muss Care-Arbeit nicht vielmehr gleichberechtigt neben dem Job und anderen Aspekten des Lebens Raum finden? Vieles muss neu verhandelt werden, viele dieser Beziehungsgespräche dürften wenig romantisch verlaufen. Doch es lohnt sich, denn der Aktionsraum vieler Männer kann so deutlich größer werden. Es steht viel auf dem Spiel, denn ein individueller wie kollektiver Bewusstseinswandel hätte immense Effekte.
Männer können die Ellenbogen anlegen
Das Wirtschaftssystem braucht zweifellos ebenso deutliche Veränderungen wie die privaten und familiären Sphären. Wenn Männer nicht mehr selbstverständlich als Ressource zur Verfügung stehen, die von ihren Arbeitgebern nach Gutdünken eingesetzt werden dürfen, dann entsteht plötzlich Raum: für die Neuverhandlung der Work-Life-Integration, aber auch für weibliche Karrieren. Männer werden merken, wie bereits dadurch Entlastung eintritt, dass sie die Ellenbogen gelegentlich anlegen dürfen. Einmal raus aus dem beruflichen Hamsterrad: Die eigenen Prioritäten neu justieren und die eigene Rolle und Verantwortung reflektieren. Natürlich haben nicht alle Männer diese Möglichkeiten. Viele unterliegen Zwängen, nicht zuletzt ökonomischen. Aber auch diese Tatsche hängt ursächlich mit festgefahrenen Rollenmustern zusammen. Das Potenzial zur Befreiung ist riesig.
In der Corona-Krise wird offenbar, wie sehr sich Menschen nach einfachen Lösungen sehnen. Einerseits werden die Rufe nach dem starken Mann laut, der die Nation durch den vermeintlichen Ausnahmezustand führt. Andererseits gerieren sich viele sogenannte Spitzenpolitiker des Landes auf eine Weise anachronistisch, die bei aller unfreiwilligen Komik Angst macht. Männer posieren auf Flughafen-Rollfeldern vor Paletten mit Schutzmasken oder zeigen sich als Macher inmitten ihrer oft rein männlichen Krisenstäbe. Derlei Bild-Propaganda kannte man bislang eher aus Russland oder Nord-Korea. Doch anstatt sie zu verlachen, ernten diese Typen nicht wenig Zuspruch in Social Media oder den Kommentarspalten der News-Plattformen. „Neue Männer braucht das Land“, sang einst Ina Deter. Selten galt dies so sehr wie in diesem Moment.
Männer brauchen Mut
Es braucht nicht zuletzt Männer, die Ambivalenz zulassen. Die in der Lage sind, Fehleinschätzungen zuzugeben und neu Gelerntes in ihre Perspektiven einzubauen. Ich wünsche mir mehr Mut zu Unsicherheit und Verletzlichkeit. Mut zum Hinterfragen der eigenen Einschätzung und zum Ausstieg aus dem permanenten Schwanzvergleich. Die Welt ist komplex, nicht zuletzt deshalb brauchen wir ein breites Repertoire an Emotionen und Denkweisen. Wir Männer haben hier Nachholbedarf. —
Hinweis: Dieser Beitrag erschien erstmals im femMit-Magazin 1/2020.
Bild: Adobe Stock / Zubada