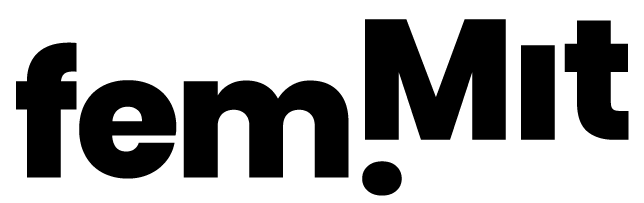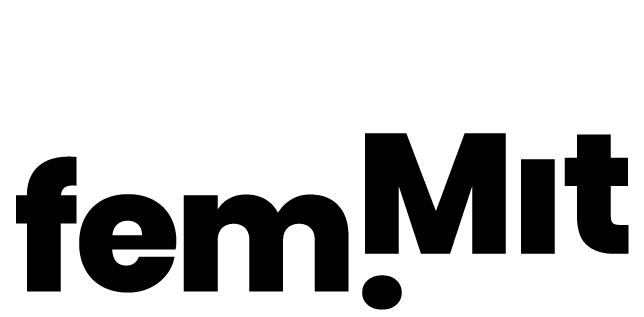Frauendomäne: Medizin
Weit oben in der Krankenhaus-Hierarchie stehen selten Frauen. Nur 13 Prozent arbeiten in Spitzenpositionen, etwa als Chefärztin oder Klinikdirektorin. Das alte Klischee, Frauen assistieren – Männer dirigieren, gilt das noch in der Medizin? Welche Frauen prägten eigentlich die Geschichte der Medizin und welche beeinflussen sie heute? Wie weiblich ist die Medizin und wo verändert sich etwas für Frauen?
Text: Sofie Flurschütz
Die Anatomie der gläsernen Decke
In Deutschland zählen laut Statistischem Bundesamt 5,7 Millionen Berufstätige zum Gesundheitspersonal. 75 Prozent davon sind Frauen. Die meisten Frauen arbeiten in ambulanten und stationären Einrichtungen wie Praxen von Ärzt:innen und Zahnärzt:innen sowie in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen.
Die Medizin ist weiblich, das zeigen auch aktuelle Zahlen aus der Charité – Universitätsmedizin Berlin: Mehr als 60 Prozent der Medizinstudierenden sind Frauen. Toll, oder? Nicht ganz. Obwohl Medizinerinnen in Studium und Weiterbildung die Mehrheit stellen, gehören die Top-Jobs meist den Männern. „Ärztinnen haben sich zwar, was die Gesamtzahl in der Ärzteschaft betrifft, gut etabliert und stellen nahezu 50 Prozent der Ärzteschaft, jedoch in den Spitzenpositionen, in Führungsaufgaben und als Inhaber von Praxen finden sich mehr Ärzte“, bestätigt Dr. med. Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes (DÄB). Auch wenn die Frauen in der Medizin zahlenmäßig keine Randgruppe mehr darstellen, macht das die Arbeit des DÄB nicht überflüssig. „Wir wollen eine gleichmäßig verteilte Besetzung von Männern und Frauen in Gremien, um dem weiblichen Blick mehr Raum zu geben“, informiert die Ärztin. Dabei denkt sie an Ärztekammern, Kassenärztliche Vereinigungen, aber auch an Berufungskommissionen an den Universitäten.
„Ärztinnen, die Mütter werden und sind, reduzieren häufig ihre Stelle, sind so viel später erst in der Lage, eine Führungsposition zu übernehmen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss weiterentwickelt und an den ärztlichen Beruf auch zeitlich angepasst werden.“
Dr. Christiane Groß, Präsidentin Deutscher Ärztinnenbund
Hürden und Hindernisse
Unbewusste Benachteiligungen im Forschungsalltag, wenig Förderung im Beruf sowie der Kampf gegen das tradierte Rollenverständnis: Für Ärztinnen ist es oft schwer, den Berufsalltag und Familie zu gestalten. „Das größte Karrierehindernis der Medizinerinnen ist Schwangerschaft und Elternzeit“, sagt die DÄB-Präsidentin und ergänzt „Ärztinnen, die Mütter werden und sind, reduzieren häufig ihre Stelle, sind so viel später erst in der Lage, eine Führungsposition zu übernehmen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss weiterentwickelt und an den ärztlichen Beruf auch zeitlich angepasst werden.“ Die schlechte Umsetzung der Mutterschutzgesetze verschärfe die Situation, da die Ärztinnen wegen der Beschäftigungsverbote kaum eine Chance haben, adäquat weiterzuarbeiten. Schon Studentinnen leiden darunter, weil sie ihre Kurse nicht weiterführen dürfen und so schon während des Studiums der Karriereknick beginnen könne. „Während die angestellte Tätigkeit in den Jahren der Facharztweiterbildung bei Ärztinnen und Ärzten eher ausgeglichen ist, wählen mehr Ärztinnen als Ärzte die angestellte Tätigkeit nach der Facharztqualifikation. Sie bleiben daher abhängig beschäftigt, oft in der Zeit mit kleinen Kindern in einer Teilzeitstelle. Diese Ungleichheit hat Auswirkungen bis in das Rentenalter, weil die Teilzeitstellen und die Ausfallzeiten durch die Kinder nur selten ausgeglichen werden“, erklärt Dr. Groß. Sie weiß, dass viele Frauen auch durch ein inneres Hindernis, der oft überhöhten Selbstkritik, gehemmt sind. „Frauen in Führungspositionen sind zusätzlich gefordert, weil sie von der Gesellschaft noch kritischer beobachtet werden“, sagt die Ärztin.
Dazu kommt: Ärztinnen versorgen Patient:innen anders. Nach Analysen des Zentralinstitutes für Kassenärztliche Versorgung nehmen sich Medizinerinnen über alle Fachgruppen hinweg pro Patient:in mehr Zeit als ihre männlichen Kollegen. In mehreren Studien gebe es zusätzlich Hinweise, dass Ärztinnen seltener Antibiotika verschreiben und die Lebenssituation der Patient:innen besser im Blick haben. „Sich mehr Zeit für Patient:innen zu nehmen, kann man sich im Krankenhaus leider nicht immer leisten. Oft bekommt man die Aussage: ,Sie arbeiten nicht schnell genug!‘ Daher verschwinden viele dieser Frauen nach ihrer Pflichtzeit schnell aus den Krankenhäusern, weil sie in der ambulanten Medizin flexibler sind“, informiert Dr. Hatun Karakaş, Ärztin für Innere Medizin.
Chronik der Emanzipation
Als der DÄB 1924 gegründet wurde, waren Frauen in der Medizin noch Exotinnen. Im 18. und 19. Jahrhundert galt es zudem als wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen unfähig sind, zu studieren. Josepha von Siebold ließ sich dennoch nicht aufhalten und wurde Hebamme. 1815 erhielt sie als erste Frau die Ehrendoktorwürde. In der Geschichte der Medizin ist sie damit eine Pionierin und eine Ausnahme, denn noch fast hundert Jahre danach schlossen deutsche Universitäten Frauen vom Studium aus. Trotzdem gelang es Frauen, an neuen Behandlungsmethoden zu arbeiten, medizinische Einrichtungen zu gründen oder alternative Heilverfahren zu entwickeln. Um anderen Menschen zu helfen, sie zu schützen und zu heilen, riskierten viele Frauen ihr Leben und entschieden sich bewusst gegen zeitgemäße Vorstellungen, nahmen Unannehmlichkeiten und Armut auf sich. So auch Rahel Hirsch, die erste Frau, die in Deutschland 1913 zur Professorin der Medizin ernannt wurde, oder Christiane Nüsslein-Volhard. Sie erhielt 1995 den Nobelpreis für Medizin und ist damit die erste und bisher einzige deutsche Frau mit einer solchen Auszeichnung.
„Frauen haben es schwerer, sich beweisen zu müssen, was fachliche Kompetenz betrifft. Medizinerinnen mit Migrationshintergrund
Dr. Hatun Karakaş
und insbesondere mit Kopftuch haben es noch schwerer.“
Powerfrauen der Medizin
Eine Frau, die ebenfalls ihren Weg in einer von Männern dominierten Klinik- und Forschungswelt gegangen ist, ist Herzchirurgin Dr. Dilek Gürsoy. Sie ist die erste Frau in Europa, die ein Kunstherz einsetzte. „Kunstherzimplantation ist viel spezieller als Herztransplantation, was auch viele andere Zentren und Unis anbieten. Diese besondere Spezialisierung ist es, um die mich viele Kollegen beneiden, denn das können nur eine Handvoll Chirurgen in Europa und ich bin aktuell die einzige Frau“, erklärte sie in einem Interview. Viel Energie investiert und beharrlich ihr Ziel verfolgt, das hat auch Dr. Karakaş. „In den Führungspositionen dominieren weiterhin männliche Kollegen“, schildert sie und ergänzt: „Aber was ich merke, ist, dass Frauen immer mehr als Kolleginnen geschätzt werden, vor allem in chirurgischen Fächern, die lange männlich dominiert waren.“ Dass Männer bevorzugt werden, fällt Dr. Karakaş oft auf. „Frauen haben es schwerer, sich beweisen zu müssen, was fachliche Kompetenz betrifft. Medizinerinnen mit Migrationshintergrund und insbesondere mit Kopftuch haben es noch schwerer“, sagt die muslimische Ärztin. Verwechslungen mit der Reinigungskraft und misstrauische Blicke seitens der Patient:innen und Angehörigen sei sie gewohnt. „Einige fragten auch mal, ob es denn keine anderen Ärzte gibt. Ich habe das Gefühl, dass es kein Problem für einige zu sein scheint, wenn wir Reinigungskräfte in der Gesellschaft sind, aber sobald man in höhere Ebenen steigt, traut man uns das nicht zu“, so Dr. Karakaş.
Der Mann als Maß aller Dinge
Unsere Welt ist von Männern für Männer gemacht und tendiert dazu, die Hälfte der Bevölkerung zu ignorieren, sagt Caroline Criado-Perez. Die Autorin schreibt unter anderem darüber, dass es in vielen medizinischen Bereichen weniger Daten zu Frauen als zu Männern gibt. Frauen sind jedoch keine kleinen Männer. Frauen sind anders krank, weisen bei vielen Erkrankungen andere Beschwerdebilder auf als Männer, gehen anders mit sich und ihren Erkrankungen um und benötigen dementsprechend unterschiedliche Behandlungsansätze. Aber: Geforscht, gelehrt und getestet wird kaum an Frauen. In der Medizin gilt: Männlich sein ist der Normalzustand – vor allem bei der Erforschung von Medikamenten.
„Geschlechtersensibel zu forschen, bedeutet für mich, die Unterschiedlichkeit von Menschen in allen Studien zu berücksichtigen, und das Geschlecht ist da ein wesentlicher Faktor. Mich interessieren personalisierte Präventionsangebote, die auf diese Unterschiedlichkeiten zugeschnitten sind.“
Prof. Dr. Gertraud Stadler
Bikini-Medizin
Haben Sie schon mal von „Bikini-Medizin“ gehört? Der Begriff beschreibt den Irrglauben, dass sich Männer und Frauen nur durch ihre Fortpflanzungsorgane unterscheiden. Gleichzeitig gibt der Ausdruck wieder, dass sich die Forschung bei Frauen vor allem auf die Stellen des Körpers konzentriert, die von einem Bikini bedeckt werden, also Brüste und Unterleib. Ein Umstand, den Prof. Dr. Gertraud Stadler ändern will. Sie leitet das seit 2007 eigenständigen Institut Gender in Medicine an der Charité. „Geschlechtersensibel zu forschen, bedeutet für mich, die Unterschiedlichkeit von Menschen in allen Studien zu berücksichtigen, und das Geschlecht ist da ein wesentlicher Faktor. Mich interessieren personalisierte Präventionsangebote, die auf diese Unterschiedlichkeiten zugeschnitten sind“, sagt die Psychologin. Sie lehrt zudem als Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung. „Mit meiner Forschung und Lehre möchte ich dazu beitragen, dass Studierende lernen, in ihrem späteren Berufsleben mit Geschlechtersensibilität und vielfältigen Lebensentwürfen umzugehen“, sagt Dr. Stadler.
Widerstand und Wutposting
Viele Frauen setzen sich nicht nur für andere Frauen ein, sondern für den gesamten Berufsstand. Eine davon ist Franziska Böhler. Sie ist Krankenschwester in einer Klinik bei Frankfurt am Main und liebt ihren Beruf. Aber die Bedingungen, unter denen das Pflegepersonal ihn ausüben muss, hält sie für untragbar. Böhler kritisiert das Gesundheitssystem, das immer öfter der Gewinnorientierung diene und immer seltener dem Menschen. Nina Böhmer sieht das ähnlich. Sie arbeitet in unterschiedlichen Berliner Krankenhäusern und endete im März 2020 einen Post auf Facebook mit den Worten: „Wenn ihr helfen wollt oder zeigen wollt, wie viel wir wert sind, dann helft uns, für bessere Bedingungen zu kämpfen.” Viele Leute haben ihr gedankt, dass das endlich mal jemand ausspreche. „Bis zu diesem Tag hatte ich auf Social Media noch nie über die Pflege gesprochen, mich sonst nur in der Arbeit aufgeregt“, sagte die Krankenpflegerin in einem Interview. „Wenn man relevant für das System ist, dann ist das etwas Schönes. Dann müsste man aber auch so behandelt werden“, ist sich Böhmer sicher. Sie ruft dazu auf, Petitionen zu unterschreiben oder an Demonstrationen teilzunehmen, damit sich für alle Frauen und Männer in der Medizin etwas ändert. —
Dieser Text erschien in der 3. Ausgabe des femMit-Magazins
Bild: Adobestock/Kzenon
femMit-Magazin bestellen
-
 femMit Magazin 3 – E-Paper3,90 €
femMit Magazin 3 – E-Paper3,90 € -
 femMit Magazin 2 – E-Paper3,90 €
femMit Magazin 2 – E-Paper3,90 € -
 femMit Magazin 1 – E-Paper3,90 €
femMit Magazin 1 – E-Paper3,90 €