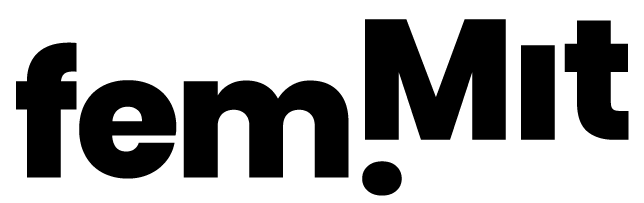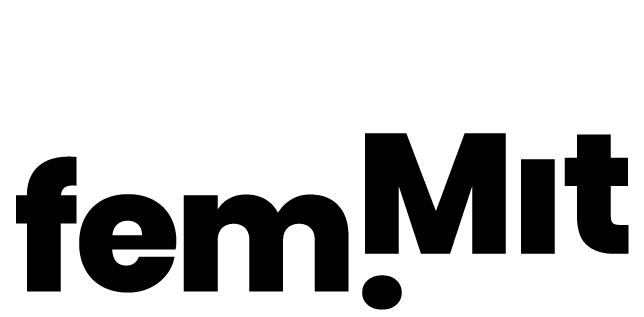Im Kampf gegen den Krebs
Nach ihrem Medizinstudium in Tübingen, Aberdeen (UK) und Nijmegen (NL) und der Ausbildung zur Fachärztin in Nijmegen arbeitete Prof. Dr. med. Dr. Esther Troost als Oberärztin der Radioonkologie in Maastricht. Seit 2015 ist sie Professorin für Bildgestützte Hochpräzisionsstrahlentherapie. Heute leitet sie im Alter von gerade mal 43 Jahren als eine von zwei Direktorinnen die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie in Dresden. Sie forscht am hochmodernen OncoRay, dem Nationalen Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie, und ist zudem seit einem Jahr Forschungsdekanin der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus an der TU Dresden.
Text: Katalin Valeš
Am Wochenende schläft sie gerne mal aus. Da klingelt der Wecker von Esther Troost erst um sechs Uhr früh statt um fünf. Den Start in den Tag bezeichnet die Medizinprofessorin und Expertin für Bildgestützte Hochpräzisionsstrahlentherapie als eine Reihe von „Genussmomenten“: Duschen, Meditieren und Frühstücken. Pünktlich um 5.45 Uhr geht’s in Wanderkleidung und robusten Schuhen mit Hund Hannah los zur Hunderunde, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Die französische Schäferhündin und sie sind jeden Morgen eine Dreiviertelstunde unterwegs, bevor es mit dem Rad die 12,5 Kilometer zur Arbeit geht. Die Welt ist noch ruhig, kein Telefon klingelt, ihr Mann schläft noch. Die ersten beiden Stunden des Tages gehören der Medizinprofessorin ganz allein. Hier sortiert sie sich und bereitet sich mental auf den Tag vor. Und dann geht’s los: Medizinische Forschung betreiben, eine Klinik leiten, Therapiepläne besprechen, sich für Nachwuchsförderung einsetzen, Netzwerke pflegen, Ängste nehmen und vor allem: Den Kampf gegen verschiedenste Krebserkrankungen mit modernster Technik versuchen zu gewinnen.
Fröhlich streckt Professorin Esther Troost den rechten Ellenbogen zur Begrüßung entgegen, lächelt und nickt. Die Chefärztin mit niederländischen Wurzeln leitet als eine von zwei Direktorinnen die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des Dresdner Universitätsklinikums. Das Teilen dieser Führungsposition ermöglicht es ihr, eigene Forschung zu betreiben und weitere Verantwortungsbereiche zu übernehmen. So ist sie beispielsweise im Gebäude nebenan, dem Nationalen Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie, kurz OncoRay, verantwortlich für die Forschungsgruppe „Bildgestützte Hochpräzisionsstrahlentherapie“.
Die Menschen, mit denen Esther Troost es zu tun hat, interessieren sie. Nicht nur als medizinische Forschungsobjekte. Die Professorin will wissen, was die Menschen bewegt. Mühelos knüpft sie bei Gesprächen dort an, wo sie vor Wochen oder Monaten geendet haben. Sie fragt nach den Dingen, von denen sie weiß, dass sie einem wichtig sind, selbst wenn die Treffen weit zurückliegen. Ihr Terminkalender ist auf die Minute genau geplant. Doch wer ihr gegenübersitzt, kann sich ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit sicher sein. „Wenn ich da bin, bin ich da. Wenn ich Forschung mache, forsche ich. Wenn ich in der Klinik bin und eine Mitarbeiterin Sorgen hat, bin ich voll und ganz dort“, sagt sie. Für diese Einstellung wird sie geschätzt – von denen, die sie behandelt, sowie von denen, die mit ihr zusammenarbeiten.
Esther Troosts Expertise sowie ihre konstruktive und pragmatische Art, Probleme anzugehen, sind gefragt: Seit einem Jahr ist sie Forschungsdekanin der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Ihre Mission: Mehr Frauen für Karrieren in Führungspositionen zu begeistern und sich für den wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Bereich starkzumachen. Dazu möchte sie bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen schaffen und Forschung während der Arbeitszeit ermöglichen statt nach Feierabend. Esther Troost weiß selbst, wie wichtig ein Umfeld ist, das es jungen Medizinerinnen und Medizinern ermöglicht, Wissenschaft und Praxis gut miteinander zu verbinden. Ihre Weiterbildung zur Fachärztin absolvierte sie im niederländischen Nijmegen an einem Krankenhaus, das ihr die gleichzeitige Habilitation ermöglichte. Das war ihr wichtig, denn die ambitionierte Ärztin ist auch eine ambitionierte Wissenschaftlerin. Die Liste von Veröffentlichungen in internationalen, renommierten Zeitschriften ist beachtlich. „Es macht eben Spaß“, sagt sie und lächelt dabei schelmisch. Und nicht nur das: Ihre Wissbegier erhöht auch die Chance auf Heilungserfolge. Daher ist der Freitag in ihrem Kalender als Forschungstag bewusst reserviert als Tag ohne Termine; ein Tag, an dem sie möglichst von zu Hause aus arbeitet: „Ich frage mich dabei immer, wie kann ich die Behandlung für die Patienten und Patientinnen so mitgestalten, dass sie in Zukunft einen Vorteil davon haben?“ In ihren Augen gehören Theorie und Praxis zusammen und befruchten sich gegenseitig. Mehrfach wurde sie für ihre patientenorientierte Forschung ausgezeichnet. Außerdem engagiert sie sich in Vorständen von nationalen und internationalen Berufsverbänden im Bereich der Radiotherapie und Onkologie sowie in einschlägigen Netzwerken. Krebs lässt sich nur interdisziplinär besiegen.
»Wenn ich da bin, bin ich da. Wenn ich Forschung mache, forsche ich. Wenn ich in der Klinik bin und eine Mitarbeiterin Sorgen hat, bin ich voll und ganz dort.«
Esther Troost
Ruhig und organisiert geht es nachmittags zu auf den Gängen des OncoRay. Kein hektisches Gewusel, gedämpfte Stimmen. Alles läuft nach Plan. In jedem Gang, in jedem Zimmer eine Uhr. Hin und wieder öffnen und schließen sich Schiebetüren mit einem leisen Zischen. An einigen Wänden warnen dreieckige, gelb-schwarze Aufkleber vor Strahlung. Zeitgleich laufen gerade vier große Bestrahlungsmaschinen auf der Station. Unaufgeregt, mit einem leisen Surren, vernichten sie bösartige Tumorzellen. Nach knapp 15 Minuten ist die Behandlung vorbei. Vier Geräte, die zur selben Zeit bestrahlen, das bedeutet für vier Menschen zur selben Zeit: Hoffen, dass es gut gehen wird und die Heilung gelingt. Dann kommen die nächsten dran. Damit alle die richtige Behandlung bekommen, wird mit Gesichtsscan die Identität überprüft. Etwas surreal mutet es an, wenn ein Mann mittleren Alters auf wackligen, nackten Beinen, in ein Handtuch gehüllt, konzentriert in eine flache Glasscheibe blickt, die in der Wand eingelassen ist und so aussieht, wie aus einem Science-Fiction-Film. Doch es ist keine Fiktion, sondern realer Schutz für die Patientinnen und Patienten. In Bereichen, in denen sich Patienten und Patientinnen aufhalten, lassen Fototapeten mit Naturmotiven die Krankenhausatmosphäre vergessen. Die medizinischen Geräte sind hochmoderne Waffen im Kampf gegen Krebserkrankungen. Oft schaffen sie es, die Krankheit zu besiegen, aber nicht immer.
Bald soll auch eine Fototapete im weiß gestrichenen Arbeitszimmer der Assistentinnen und Assistenten für medizinisch-technische Radiologie für eine angenehmere Atmosphäre sorgen. Das Team soll sich wohlfühlen. „Als Zeichen von Glück und auch Hoffnung wurden Kleeblätter gewünscht“, erzählt Esther Troost beim Rundgang und erkundigt sich bei der Gelegenheit gleich, ob das noch so ist. Die Radiologie-Assistentin in der typisch blauen medizinischen Berufsbekleidung lächelt, nickt. Dann schaut sie wieder konzentriert auf den Bildschirm, der ihr zeigt, was im Nebenzimmer geschieht. Gerade wird dort ein Patient auf einer Liege in der Protonengantry bestrahlt. Langsam dreht sich der große Bestrahlungskopf um den Mann. „Hier kommen die Protonen heraus und bestrahlen bei diesem Patienten die Prostata“, erklärt Esther Troost und deutet dabei auf den Monitor. Die positiv geladenen Teilchen sind unsichtbar. Sie werden auf bis zu zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und zerstören Krebsgeschwüre. Die Behandlung mit Protonen ist sehr präzise, hochwirksam und schont das umliegende Gewebe. Wenn Esther Troost über die modernen Bestrahlungsgeräte spricht und von den Fortschritten im Bereich der Krebstherapie, ist die Onkologin in ihrem Element. Dresden ist einer von vier Standorten in Deutschland, an denen derartige Behandlungen überhaupt durchgeführt werden können. Troost ist stolz auf die technische Ausstattung ihres Arbeitsplatzes und die Möglichkeit, Theorie und Praxis so gut miteinander verzahnen zu können.
Für Laien mag das Arbeitsgebiet von Esther Troost abstrakt erscheinen. Viele können sich unter Operationen mehr vorstellen als unter Bestrahlung. Die Strahlen sind nicht zu sehen, zu hören, zu riechen, zu fühlen oder zu schmecken. „Doch die Behandlung ist hocheffektiv. Jeden Tag zerstören wir mit der Strahlentherapie einen Teil der vorhandenen Tumorzellen“, erklärt Esther Troost. Es geht hier sehr oft um Leben und Tod.
»Ohne den Kontakt wüsste ich ja nicht, wo wir noch besser werden müssen. Deshalb ist der Patientenkontakt für mich Quelle der Inspiration auch für Forschung.«
Esther Troost
Eine den Patient:innen zugewandte Denkweise
Das weiß auch Ulrike Baumann, Mathematik-Professorin am Institut für Algebra an der TU Dresden aus eigener Erfahrung. Vor sechs Jahren wurde bei ihr eine äußerst seltene Erkrankung festgestellt: ein Marginalzonenlymphom der Haut, da war sie 54 Jahre alt. Daraufhin wurde ihr empfohlen, eine Strahlentherapie bei Professorin Esther Troost zu machen.
Wer mit Ulrike Baumann sprechen möchte, verabredet sich mit ihr am besten zum Geo-Caching an der Elbe – eine digitale Schatzsuche. „Ich mag es, draußen zu sein, die Bewegung, diese Freude, wenn ich etwas finde, das macht mir Spaß“, sagt die Mathematikerin mit viel Begeisterung in der Stimme. Gerade eben hat sie sich in ein kleines Logbuch eingetragen, das sie nun vorsichtig und mit einem zufriedenen Lächeln zurück in das Versteck unter einen alten Bauwagen am Elbufer legt. Ihre Augen blicken fröhlich durch die Brille mit dem dünnen, schwarzen Rand. Ulrike Baumann und Esther Troost, beide rational, analytisch und lösungsorientiert veranlagt, verstanden sich auf Anhieb. Die Patientin fasste schnell Vertrauen: „Esther Troost ist eine aufgeschlossene Person mit einer ganz natürlichen Art und mit einer sehr patientenzugewandten Denkweise. Das hat mich von Anfang an stark beeindruckt.“ Wenn sie von der Professorin erzählt, leuchten ihre Augen noch mehr als sonst. „Ich bin es nicht gewöhnt, krank zu sein, krebskrank zu sein. Um mich zu beruhigen, brauchte ich erstmal jede Menge Informationen. Frau Troost hat das gespürt und sich für mich in einer Weise Zeit genommen, wie sie sich überhaupt nicht hätte Zeit nehmen müssen. Ihre Haupttätigkeit ist es ja nicht, die Hand von Patientinnen und Patienten zu halten, sondern mit viel technischen und medizinischen Know-How herausfinden, wie man einen Tumor zu Leibe rückt.“ Das aufrichtige Interesse der Ärztin an ihr als Patientin imponierte der Mathematikprofessorin. „Die Frau ist echt! Sie gibt totale Sicherheit!“ Vor ein paar Tagen ist Ulrike Baumann 60 geworden. Die letzte Nachsorgeuntersuchung vor einem Monat zeigte: Alles in Ordnung.
Auch bei Arno Schmidt hat sich die tiefe Menschlichkeit der Ärztin eingebrannt. Vor ein paar Jahren war der heute 75-jährige Dresdner bei ihr in Behandlung. Am großen, dunklen Esstisch in seinem Haus am Stadtrand von Dresden spricht der ehemalige Zahntechniker und Medizinpädagoge über die Begegnung mit ihr: „Ich habe mich bei Frau Professorin Troost immer gut aufgehoben gefühlt“, sagt er. „Sie hat alles so erklärt, dass ich es verstanden habe. Die Folgen und Chancen hat sie klar benannt.“ Einmal hat sie ihn sogar mal an einem Samstag angerufen, erzählt er und stellt seine Tasse Kaffee ab: „Zuerst hatte ich einen riesigen Schreck bekommen, als ich ihre Nummer sah. Aber sie beruhigte mich und sagte, dass sie mir nur mitteilen wollte, dass alle Werte in Ordnung sind. Sie hatte sich gemerkt, dass ich an diesem Tag in den Urlaub fahren wollte, und kam gerade von einem Kongress im Ausland nach Hause. Mich hat diese menschliche Begleitung sehr berührt, denn bei dieser Art von Erkrankung ist die Angst, nicht mehr zu genesen, allgegenwärtig.“
Was Arno Schmidt außerdem imponierte: „Sie ist eine Ärztin, die sich ständig weiterbildet, die Tagungen besucht und sich beliest.“ Arno Schmidt, der für die von ihm mitbegründete FDP-Ost eine Zeitlang im Bundestag saß, überlegt derzeit, ob er noch promovieren sollte. Mit 75 Jahren. Esther Troost hat großen Anteil an seinem Lebensmut.

Vertrauen ist wichtig für den Heilungsprozess
„Ein Teil des Erfolges einer Behandlung hängt davon ab, ob eine Patientin oder ein Patient Vertrauen hat in das, was das Team mit einem vorhat“, sagt Esther Troost später bei einem Spaziergang in der Mittagspause am Elbufer. Sie finde es wichtig, Stabilität auszustrahlen und den Kampfgeist, es gemeinsam zu schaffen. „Wenn ich da als Ärztin nicht versuche, Coach zu sein, dann geht’s schief, glaube ich.“ Das Verhältnis zu den Patientinnen und Patienten bezeichnet sie als Basis für ihre Arbeit. „Ohne diesen Kontakt wüsste ich ja nicht, wo wir noch besser werden müssen. Deshalb ist der Patientenkontakt für mich Quelle der Inspiration auch für Forschung“, sagt sie.
Und dann gibt es die Tage, die grauer sind. Alle retten können sie und ihr Team nicht. Manchmal macht sie das wütend, gerade wenn ihr jemand ans Herz gewachsen ist. Die Traurigkeit lähmt allerdings nicht, sie treibt an. Esther Troost ist eher rationaler Natur. „Ich habe nie mit einem Patienten geheult, aber natürlich auch mal das Sprechzimmer verlassen und abends gedacht: ‚Scheiße!‘“ Doch nach zwei, drei Tagen blickt sie wieder nach vorn: „Mich macht sowas kampfeslustig, nach neuen Methoden zu schauen, diese Erkrankung doch zu besiegen, und nach Wegen zu suchen, dass es den nächsten Patienten oder die nächste Patientin nicht so hart trifft.“ Dabei setzt sie auf die Zusammenarbeit mit Experten und Expertinnen aus anderen Fachdisziplinen.
»Traut euch!
Auch wenn ein Schuh zunächst noch eine halbe Nummer zu groß erscheint, zieht ihn euch an, der wird schon bald passen. Vor sechs Jahren -hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt eine Klinik leite.«
Esther Troost
Karriere in der Medizin – Erfolgsfaktor Zuversicht
Ihre intrinsische Neugier an der Wissenschaft und ihre aufrichtige Anteilnahme am Schicksal ihrer Patienten und Patientinnen, aber auch ihre Fähigkeit, Karrierechancen zu erkennen und zu nutzen, gehören sicherlich zu den Erfolgsfaktoren in ihrer Karriere. Esther Troost sagt, dass ihr die jeweils nächste Karrierestufe oftmals angeboten worden sei, dass sich ihr Chancen geboten haben in bestimmten Phasen ihres Lebens und dass auch der Zufall öfter eine Rolle gespielt habe. Außerdem habe sie in entscheidenden Situationen gute Beraterinnen und Berater an ihrer Seite gehabt. Doch was nützen die glücklichsten Zufälle, wenn am Ende der Mut und das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefehlt hätten? Gerade Frauen seien da oft zurückhaltender. Als sie im vergangenen Jahr Forschungsdekanin werden sollte, hat sie verschiedene Männer und Frauen zu diesem Schritt befragt. Ihre Mini-Umfrage ergab: Alle Frauen brachten Einwände vor und zählten auf, was sie sonst noch alles zu tun hat. Und die Männer? Die sagten geschlossen: „Das ist doch gar keine Frage! Natürlich machst du das.“ Esther Troost hat zugesagt und für sich festgestellt: Es geht, und zwar sehr gut. „Die unterschiedlichen Aufgabengebiete befruchten sich gegenseitig.“
Daher ihr Rat für eine Karriere in der Medizin, insbesondere an Frauen: Wenn mal eine Chance da ist, nicht ewig darüber nachdenken, sondern zugreifen. „Traut euch! Auch wenn ein Schuh zunächst noch eine halbe Nummer zu groß erscheint, zieht ihn euch an, der wird schon bald passen. Vor sechs Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt eine Klinik leite. Es war damals nicht mein Ziel, nach Dresden zu kommen und eine Klinik zu leiten, und jetzt ist es trotzdem so.“
Es gibt ihrer Meinung nach immer noch zu viele Frauen, die denken, dass sie nicht gut genug sind, dass sie Herausforderungen nicht schaffen, obwohl sie supergut sind. Zur Frauenquote hat Troost daher eine klare Meinung: „Wir brauchen sie.“ Das liege vor allem daran, dass es neben den Selbstzweifeln der Frauen noch immer gewisse Strukturen gibt, die Frauen daran hindern, Karriere zu machen.
Netzwerken ist kein Privatvergnügen
Ihr ist aufgefallen, dass Männer im Gegensatz zu Frauen häufiger sehr gute Netzwerke haben. Oft hat sie den Eindruck, dass Frauen zueinander nicht ganz so fair sind. Das sei komisch und müsse sich dringend ändern. Esther Troost findet es wichtig, dass ältere Frauen auch jüngere Frauen fördern, doch nicht einseitig. Von rein weiblichen Teams hält Esther Troost genauso wenig, wie von Teams, in denen Männer in der Überzahl sind: „Das geht schief. Die besten Teams sind die, in denen das Geschlechterverhältnis ausgewogenen ist.“ Neben der Zusammensetzung von Teams hat für Esther Troost die Qualität der Beziehung zueinander eine große Bedeutung. Gezieltes Netzwerken hält sie daher für essenziell. Ihre Erfolgsformel für gute Netzwerke besteht in ihren Augen aus sechs Bestandteilen.
- Nicht auf Kosten der anderen handeln: Entweder Win-win-Situationen schaffen oder keine.
2. Fair sein: Miteinander über Wünsche und Erwartungen sprechen.
3. Diversität: Netzwerke aufbauen, in denen Menschen mit unterschiedlichen Interessen agieren.
4. Gemeinsam wachsen: Positive Kritik ertragen können und einander gut gemeinte Ratschläge geben.
5. Emotional wertvolle Momente schaffen: Zum Beispiel bei gemeinsamen Events darauf achten, neben der Beschäftigung mit Inhalten auch eine lockere Atmosphäre zu schaffen.
6. Persönliche Wertschätzung: Superwichtig.
In ihren Augen ist Netzwerken kein Privatvergnügen, das zur Arbeitszeit on top dazu kommen muss. Sie sieht Unternehmen und Führungspersönlichkeiten in der Verantwortung, den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen Gelegenheiten zu geben, sich zu vernetzen. Wenn Esther Troost von Netzwerken spricht, dann hat sie dabei ein sehr gezieltes Vernetzen vor Augen, kein beliebiges Blabla mit irgendwelchen Menschen. „Ich genieße schöne Momente total, aber mit wenigen, ausgesuchten Leuten.“ Sie lässt sich auf ihr Gegenüber ein,
oberflächliche Small Talks sind nicht ihre Sache: „Ich würde nie auf eine Hochzeit mit 50 Gästen gehen. Das fände ich schade um meine Zeit.“
Die Kostbarkeit der Zeit
Mit ihrer Zeit geht sie sorgsam um. Viel über die Bedeutung des Lebens hat sie in den Niederlanden gelernt. Als sie neben dem Medizinstudium Nachtschichten schob, um schwerkranke Menschen auf der radioonkologischen Station zu pflegen. Einige von ihnen schafften es nicht und verstarben, andere sah sie Jahre später – genesen. Doch es geht nicht nur um die Frage nach Leben und Tod. Lebensqualität hat einen hohen Stellenwert für Esther Troost: Ein Burn-out erleiden, wie einer ihrer früheren Vorgesetzten, das möchte sie auf keinen Fall. Ganz bewusst hat sie sich daher Stopps in ihren Alltag eingebaut: „Ich gehe um sechs nach Hause. Wenn’s mal halb sieben ist, dann ist das dann so, aber bitte keine Termine bis um neun.“ Zu Hause heißt es erstmal: In Ruhe ankommen, kochen und gemeinsam mit ihrem Mann essen. Danach geht es nochmal raus mit ihrer Hündin. „Sie merkt genau, wenn ich nebenbei doch kurz eine SMS schreibe und macht dann Schabernack, so als würde sie sagen: ‚Du, wir sind jetzt im Hier und Jetzt, du brauchst nicht noch andere Sachen machen. Es reicht, wenn du das tust, warum wir hier sind, nämlich spazieren.’
Wie Esther Troost sagt, kann sie auch sehr gut nicht arbeiten. Entspannung bedeutet bei ihr: Aktivität. Im Urlaub liegt sie nicht gern faul in der Sonne, sondern geht Wandern und werkelt am Wochenende im Garten. Seit zwei Monaten hat sie ein neues Hobby: Cello spielen. Das zu lernen, war ein langgehegter Wunsch, nachdem sie 22 Jahre lang Blockflöte gespielt hatte. Ein Ziel habe sie schon: die Cello-Sonaten von Bach. Anspruchsvolle Solo-Stücke, einerseits ganz fein, andererseits ganz mächtig. Ihr Blick und ihr zuversichtliches Lächeln lassen keinen Zweifel daran, dass sie es eines Tages schaffen wird, diese Musik zu spielen. —
Hinweis: Der Text erschien erstmals im femMit Magazin Ausgabe 3.
Foto: Tobias Ritz