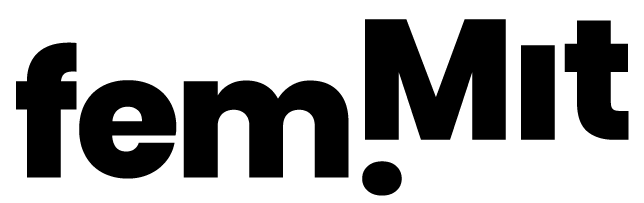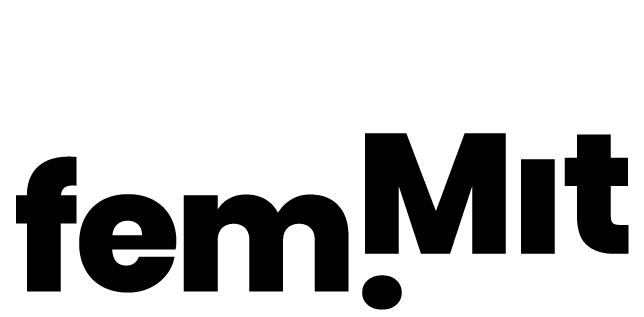Rolle, rolle, Rollenbild
Als kleines Mädchen wurde mir vieles beigebracht: Lieb sein. Ruhig sein. Brav sein. Ordentlich sein. Ich habe gelernt, wie man Wäsche bügelt, putzt und wie man kocht. Ich glaube, ich habe das meiste davon auch echt gern gemacht. Meine Vorbilder – damals, noch vor der Schule – waren meine Großmutter und Mutter. Die Männer habe ich angeschmachtet. Dem Opa habe ich immer schön das Kissen zurecht gelegt, wenn er auf seinem Fernsehsessel Platz nahm. Sagte er, ich solle ihm ein Bier holen, flitzte ich los.
Text: Romina Stawowy
In den 1980ern bei uns auf dem Dorf waren die Rollen klar verteilt. Die Männer bauten, reparierten und die Frauen kümmerten sich um das Essen, die Wäsche und putzten – und das auch, wenn die Männer schon längst mit ihrem Bier in der Sonne saßen. Die Männer sagten, wo es lang ging – zumindest war das mein Gefühl. Da wurde nicht gemeckert oder etwas infrage gestellt. Eine Windel oder den Wischeimer hat ein Mann nicht angefasst – das war unausgesprochen der Job der Frauen.
Der Autor JJ Bola beschreibt es in seinem Buch „Sei kein Mann“ so: „Das Patriarchat beeinflusst das Leben von Männern und Frauen von der Geburt über die Kindheit bis ins Erwachsenenalter und darüber hinaus, und zwar auf teils scheinbar einfache Art und Weise, wie die Farben, die sie tragen sollen, Blau für Jungs, Rosa für Mädchen, und die Art der Kleidung die sie anziehen, oder das Spielzeug, mit dem sie spielen sollten.“ Kurz gesagt, von Rollenbildern sind wir alle betroffen. Wir alle tragen sie in unseren Köpfen, ob wir wollen oder nicht. Auch wenn es nicht allen Menschen bewusst ist – tatsächlich leiden alle Geschlechter darunter. Denn auch wenn wir oft über die Rolle der Frauen sprechen, so betrifft es die Männer gleichermaßen: „Weine nicht! Sei stark! Beschütze deine Frau!“ oder für die Kinder: „So sind Jungs nun mal“ … man kennt das.
„Unser Blick auf körperliche und emotionale Stärke ist oft mit Geschlechterrollen verknüpft. Natürlich gibt es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber: Die Schlüsse, die daraus für unsere Lebensrealitäten gezogen werden, sind oft fehlerhaft und starr“, so Bola.
Nun habe ich es wohl meinem Vater zu verdanken, der sich insgeheim vielleicht nach einer Tochter einen Sohn wünschte und mich bekam, dass ich doch auch das ein oder andere handwerkliche Geschick habe – Danke an dieser Stelle. Dennoch bleibt eins: Das letzte Wort hatten und die Entscheidungen trafen bei uns, die Männer.
Bei mir selbst anfangen
Als ich dann mit 24 meinen ersten Sohn bekam, war klar: Ich bleibe zu Hause. Ich habe viele grüne und blaue Strampler gekauft und mit ihm an Baustellen gestanden und Bagger beobachtet. Weihnachten gab es die obligatorische Holzeisenbahn. Ich habe das nie infrage gestellt – der selbst gewählte Klassiker, über den ich damals auch nie nur eine Sekunde nachgedacht habe. Erst mit den Jahren, mehr Input durch Internet und Co und letztendlich auch der größer werdenden Last durch meine weiteren Kinder und den Job – Stichwort #Mentalload – kam die Erkenntnis, dass hier etwas schiefläuft.
Vor einigen Jahren dann ein zusätzlicher Aufrüttler. Der Sohn kam von der Schule nach Hause und war ganz aufgelöst. Er berichtete, seine Lehrerin habe gesagt, alle Jungen seien so laut, wild und anstrengend und die Mädchen so lieb und brav. Er wisse gar nicht, was er falsch gemacht habe und überlege schon den ganzen Tag, er sei doch immer lieb und ruhig. Und da haben wir sie, die Rollenbildzuschreibung. Mädchen sind lieb und die Jungs wild und das auch ganz unabhängig davon, ob es alle betrifft oder nicht, da werden alle in einen Topf geworfen. Ich war wütend!
So geht das nicht!
Mich als Mutter von drei Söhnen beschäftigte dann sehr: Was kann ich selbst tun, um eben nicht in diese Rollenbild-Falle zu tappen? Was kann ich tun, um meine Kinder zu gleichberechtigt denkenden und handelnden Menschen zu erziehen? Immer öfter ertappte ich mich selbst bei Sätzen, die so klassische Klischees waren, dass ich mir, nachdem sie aus meinem Mund gekommen waren, direkt auf die Lippen biss. Zu spät. Bestes Beispiel: „Weine nicht wie ein Mädchen!“ Es folgten Erklärungen, Entschuldigungen und Gespräche mit den Kindern, der Satz kam nie wieder.
„Das war schon immer so“, galt nun nicht mehr. Das bringt mich zur Frage: Was prägt unsere Kinder und sind neben der Kultur, unserem Zusammenleben, vielleicht doch auch die Gene, also die Veranlagung, entscheidend?
„Das, was uns in der Summe ausmacht, ist unser Umfeld, das, was wir täglich vorgelebt bekommen.“
Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer
Sozialisation ist entscheidend
Professorin und Hirnforscherin Bettina Pfleiderer, von der Universität Münster sagt, man wisse inzwischen, dass zum Beispiel Sexualhormone mit eine Rolle spielten. Sie beeinflussen, wie beispielsweise bestimmte Gene abgelesen werden, und sind auch mit verantwortlich für die Vernetzung bestimmter Hirngebiete. Aber ein Schwarz-Weiß gibt es nicht. Denn sie glaubt: „Das, was uns in der Summe ausmacht, ist unser Umfeld, das, was wir täglich vorgelebt bekommen. Das prägt uns und führt eben zu diesen Verknüpfungen und Vernetzungen im Gehirn. Kinder müssen sehen und erleben, dass Mutter und Vater auch vorleben, was sie sagen.“ Authentizität ist das Stichwort – Verbiegen wäre genau das Falsche. Wenn wir als Erwachsene auf einen respektvollen Umgang mit anderen Menschen und auch innerhalb unserer Familie wert legen, prägt dies auch unsere Kinder.
„Man weiß ja inzwischen auch, wenn beispelsweise Mütter in einer bestimmten Art und Weise mit ihrer Migräne umgehen, dass Kinder ähnliche Mechanismen entwickeln und nutzen, ohne das es ihnen bewusst ist,“ sagt Pfleiderer. Ähnlich sei es beim Thema Gewalt. Wenn Kinder sie im familiären Umfeld oft erleben oder bestimmte Wörter hören, handeln sie auf die gleiche Art, einfach weil sie nicht gelernt haben, dass es auch andere Möglichkeiten im Umgang gibt.
Inzwischen gibt es auch einige Studien, bei denen untersucht wurde, inwiefern gewalttätiges Spielzeug und Computerspiele Einfluss auf das Aggressionsverhalten von Kindern haben. Auch dies ist noch nicht abschließend geklärt. So kam zwar eine Studie der Iowa State University zu dem Schluss, dass Kinder nach häufigem Konsum gewaltsamer Spiele durchaus Gewalt eher tolerierten. Aber andererseits zeige die Gewaltstatistik in den USA keine nennenswerte Erhöhung, seitdem es Computerspiele gibt. Vermutlich ist dies auch nur ein Puzzlestück im großen Ganzen von dem, was uns ausmacht.
Männer, Vorbilder und Gefühle
Dem Männerforscher Christoph May fällt auf: „Männer sind oftmals unfähig, über Probleme und Gefühle zu sprechen, weil sie es zu Hause nie gelernt haben. Und auch Männerbünde basieren darauf, nicht über Gefühle zu sprechen.“ Das sei im klassischen Rollenbild des Mannes einfach nicht vorgesehen. „Männer haben’s schwer, nehmen’s leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werd’n als Kind schon auf Mann geeicht“, sang schon Herbert Grönemeyer. Und so vermitteln es uns auch die meisten Kinderbücher (siehe Seite 46) und das Fernsehprogramm (siehe Seite 68). Bilder und Sprache machen eben doch etwas mit uns.
Oder wussten Sie, dass Rosa und Rot einmal typische Männerfarben war? Absatzschuhe trugen zu Barockzeiten ausschließlich einflussreiche und wohlhabende Personen. Je höher der Absatz, desto höher der gesellschaftliche Rang. Erst mit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts waren Absatzschuhe nicht mehr up to date. Trotzdem trugen Männer bis in die 1980er Jahre durchaus noch Schuhe mit – wenn auch kleineren – Absätzen oder gleich Plateau. John Travolta in „Saturday Night Fever“ zum Beispiel oder die Band KISS. Rollenbilder setzen wir als Gesellschaft fest und genauso können wir sie auch verändern. Jeder vielleicht erst einmal bei sich und dann auch im großen Ganzen.
Von Privilegien und Angst
Wir Frauen stecken seit vielen Jahren schon in einem Veränderungsprozess – das, was als Emanzipation bezeichnet wird. Frauen haben sich entwickelt, verändert und sind mit und an neuen Aufgaben gewachsen. Sie fordern ihre Rechte ein – zu Recht. Viele Männer aber sitzen mit Scheuklappen da, ohne sich zu bewegen. Und wir Frauen knallen ihnen jetzt die Emanzipation und die Veränderung der letzten Jahre um die Ohren und fordern, dass sie jetzt doch bitte ein Stück von dem schönen und leckeren Kuchen, also der Macht, abgeben müssen – und auch hier wieder: zu Recht!
Männerforscher May sagt: „Privilegien abgeben, das macht ja keiner gern. Und das sind vor allem die unverdienten Vorteile, von denen viele Männer profitieren, nur weil sie männlich, weiß, heterosexuell, westlich gebildet oder eben reich sind.“ Hier müssten sich Männer selbst hinterfragen und erkennen, welche Vorteile sie genießen, in welchen Männerbünden und Rollenbildern sie ihren Alltag verbringen und ob sie das auch künftig tun wollen. „Mangelnde Kritikfähigkeit“ ist es, die May da auffällt: „Und mit dieser dann die Angst, Macht zu verlieren. Da kommt dann der ganze Abwehrkatalog, den man zum Beispiel in den sozialen Medien beobachtet, den vor allem Frauen kennen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen. Das Fundament von Männerbünden ist die Abwehr von Frauen.“
„Ich erlebe gerade bei älteren Vätern, die es im Nachhinein bereuen, viel zu wenig an der Erziehung ihrer Kinder teilgenommen zu haben und die vor allem gearbeitet haben und in der Ernährer- und Geldbeschaffungsrolle gewesen sind.“
Chritstoph May
Nur gemeinsam kommen wir weiter
Wie also schaffen wir es nun, die Männer mit ins Boot zu holen, die mit den Scheuklappen? Denn Veränderungen sind gemeinsam viel einfacher. „Zunächst einmal, es ist nicht Aufgabe der Frauen, die Männer mitzunehmen“, betont May. Die Mindestforderung an Männer müsse sein, dass sie beginnen, selbstkritischer zu sein und aktiv darüber nachdenken und reflektieren, wo ihre Privilegien liegen und diese auch abgeben. „Auch hier bedarf es der Vorbilder: Männer, die zeigen, wie man Männerbünde aufbricht und ächtet, und Männer, die anderen gegenüber die Stimme erheben, wenn ein unangebrachter Spruch daherkommt,“ so May.
Es gebe inzwischen viele Männer, die Interesse haben, sich mit dem Thema Gleichberechtigung zu beschäftigen: „Ich kenne viele ältere Männer, die profeministisch sind. Insgesamt aber kann ich leider nicht erkennen, dass Männer in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teilnehmen.“ Männer sollten verstehen, dass sie auch viel gewinnen können. „Ich erlebe gerade bei älteren Vätern, die es im Nachhinein bereuen, viel zu wenig an der Erziehung ihrer Kinder teilgenommen zu haben und die vor allem gearbeitet haben und in der Ernährer- und Geldbeschaffungsrolle gewesen sind.“
Jüngere Väter würden zunehmend mehr Zeit mit der Familie verbringen – Rollenbilder verändern sich. Ein guter Trend: 79 Prozent der Väter wünschen sich mehr Zeit mit der Familie (Quelle: Väterreport 2018, BMFSFJ). Aber, so wirft May ein: „Wir dürfen uns da auch nichts vormachen, nur 24 Prozent der Männer nehmen überhaupt Elternzeit in Anspruch, die meisten davon nur 2 Monate, da ist noch Luft nach oben.“
Mut, neue Türen zu öffnen
Wir haben es selbst in der Hand: Nur weil man ein bestimmtes Rollenbild vorgelebt bekommen hat, heißt es nicht, dass man das nicht für sich ändern kann. Das Gehirn arbeitet das ganze Leben lang und kann dementsprechend immer neue Verknüpfungen herstellen. Professorin Bettina Pfleiderer nutzt dazu ein Bild mit Türen in unseren Köpfen: „Die sind nämlich nie ganz verschlossen. Man kann Türen auftreten, aufbohren, mit Äxten bearbeiten oder sanft durch stoßen öffnen. Oft denkt man, sie seien zu, das ist ein Irrtum. Manchmal reicht es auch schon, eine neue Türklinke in die Hand zu nehmen und mal hinein zu schauen.“ Eine wichtige Botschaft ist: „Es gibt immer eine Tür, die man öffnen kann.“ Veränderung braucht Mut und Vorbilder, die einem auch mal eine Tür öffnen und den bekannten Stups geben.
Denn wie schreibt JJ Bola so schön: „Gleichzeitig gilt aber auch, dass wir den Mut haben sollten, uns fortzubilden, wenn wir oder andere Fehler machen, dass wir Empathie haben und da sind für diejenigen, die uns brauchen – und auch für uns selbst.“
Und nun?
Mein großer Sohn hat sich zu Weihnachten einen lila und einen pinken Pullover gewünscht, den er inzwischen mit Stolz und ganz selbstverständlich trägt. Nach vielen Gesprächen übernehmen die Kinder Aufgaben im Haushalt und helfen mit. Sie putzen oder bereiten das eine oder andere Essen zu. Geschlechterklischees werden direkt im Keim erstickt, Blondinenwitze mag hier inzwischen niemand mehr. Wir sprechen bewusst über Gefühle, Sorgen und Ängste („Ich-Botschaften“ heißt das Zauberwort). Und, was mich persönlich am meisten freut: Bei Filmen oder Dokus im Fernsehen werde ich regelmäßig über die Frauenquoten informiert.
Also, haben Sie keine Angst, wagen Sie den Versuch, wählen Sie einmal ganz bewusst eine andere Tür und schauen Sie dahinter. Dazu müssen sich Väter nicht die gleich High Heels zulegen. Aber denken Sie einmal über ihre Rollen, Werte und Vorstellungen nach und verändern Sie diese einmal ganz bewusst. Trauen Sie sich, es mal anders zu machen – auch rosa Pullover sind schick und ich versichere Ihnen, die Zeit und die Gespräche mit Ihren Kindern kann Ihnen kein Geld der Welt ersetzen – Ihre Kinder profitieren genauso davon wie Sie! —
Hinweis: Dieser Text erschien erstmal im femMit-Magazin 1/2021
Bild: AdobeStock_nadezhda1906