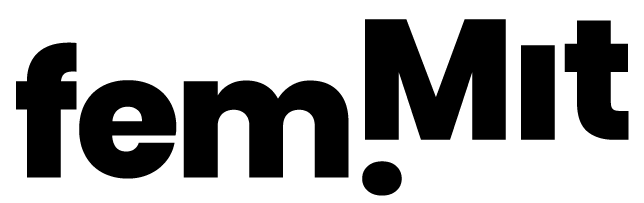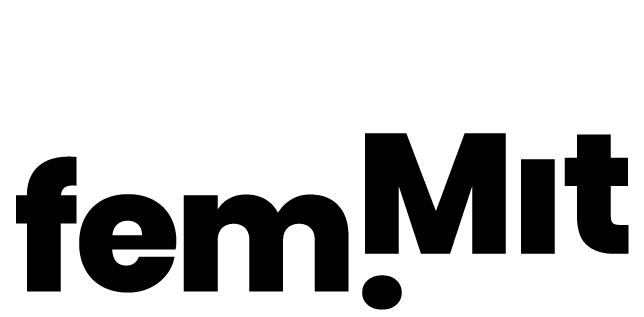Städte für alle: Gender Planning ist das falsche Wort
von Celsy Dehnert
Wer einmal einen Kinderwagen über den Gehweg einer Wohnsiedlung schieben musste – oder auf eine Gehhilfe angewiesen ist – weiß: So richtig erwünscht sind Fußgänger:innen und Radfahrer:innen in deutschen Städten nicht. Straßenlaternen sind oft so platziert, dass man mit dem Kinderwagen auf die Straße ausweichen muss. Ausreichend Platz, damit einander entgegenkommende Spaziergänger:innen sich ausweichen können? Oft Fehlanzeige. Doch müssen sich hingegen die Autos keine Gedanken um ausreichenden Platz machen.
Mobilitätsaktivistin Katja Diehl bringt das Problem unserer Städte auf den Punkt: „Wir denken vom Auto aus“. Die Frage, wer welchen Raum im öffentlichen Leben erhält, ist auch eine Geschlechterfrage. Die Annahmen darüber, wer wie viel Raum benötigt, sind in der Stadtplanung oft eng an Geschlechterrollen geknüpft. Die daraus entstehenden Raumkonflikte will das sogenannte Gender Planning auflösen, indem es die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen gleichermaßen berücksichtigt.
Gender Planning: Geschlecht als Planungsgröße
Gender Planning bedeutet geschlechtssensible Stadtplanung und beschreibt den Versuch, Stadtentwicklung für Menschen aller Geschlechter gleichermaßen zu konzipieren. Tatsächlich würde man aber von inklusiver Stadtplanung sprechen. Mobilitätsaktivistin Katja Diehl sagt: „Gender greift zu kurz. Es geht nicht nur um Gender im Planning, sondern um die Bedürfnisse aller“. Laut Katja Diehl ist Gender Planning ein Planen in Lebensphasen: „Stadtplanung muss ein Abbild der Gesellschaft sein. Unsere Stadtplanung orientiert sich jedoch ausschließlich an einem Ideal – der gesunde, weiße Mann“. Das zeigt sich darin, wer für Stadtplanung zuständig ist: Laut statista.de sind 63 % der Stadtplaner:innen Männer. Die haben vor allem ihre eigene Lebensrealität vor Augen. Im Gender Planning sollen sich all die Leute, die in solchen Planungsprozessen übersehen werden, ermutigt fühlen, ihre Bedürfnisse einzubringen, erklärt die Expertin.
Wer sind diese Leute? Im Gender Planning steckt ein Teil der Antwort: Frauen, aber nicht nur. Es geht unter anderem darum, die Mobilität sowie das Sicherheitsbedürfnis von Frauen in der Stadtentwicklung mitzudenken. Aber nicht nur ihres. Auch Kinder, Menschen mit Behinderung, Ältere, People of Color und arme Menschen haben spezifische Bedürfnisse in Bezug auf Sicherheit, Mobilität und Lebensqualität. Gender Planning ist also Stadtentwicklung, die nicht nur das Geschlecht, sondern auch das Alter, Mobilitätsfähigkeiten, sozioökonomische Unterschiede und soziale Rollen mitdenkt. Das gelingt durch ganz einfache Maßnahmen: Ausreichend ausgeleuchtete Gehwege oder genügend Bänke, auf denen man sich ausruhen kann. Gehwege, die breit genug für Rollstühle sind oder ein erschwinglicher öffentlicher Personennahverkehr. Auch ob ausreichend Toiletten vorhanden sind oder ob Skate-Anlagen und Spielplätze zugänglich sowie sicher sind, spielt in der Stadtplanung eine Rolle.
Beispiel Wien
Das Handbuch „Gender Mainstreaming in der Stadtplanung und Stadtentwicklung“ der Stadt Wien sagt, Gender Planning „agiert ortsbezogen und gruppenspezifisch“. Das bedeutet, dass bei der Stadtentwicklung jeder Ortsteil für sich betrachtet wird. Ein großer Baustein in der Umsetzung ist dabei die Bürgerbeteiligung. Im Fokus der Analyse stehen allerdings die Nutzer:innengruppen, die am engsten an ihr Wohnumfeld gebunden sind. Anders als sonst werden also nicht nur arbeitende Männer in SUVs befragt, sondern vor allem Kinder, Frauen mit Fürsorgeverantwortung, Senior:innen und Menschen mit Behinderung. Die Folge dieser Herangehensweise: In diesem Gender Planning werden nicht nur Sicherheits- und Mobilitätsbedürfnisse sichtbar, sondern auch die alltäglichen Wegeketten der Menschen neu arrangiert. Ein Anliegen, das vor allem Frauen bzw. Menschen mit Fürsorgeverantwortung betrifft.
Für den „Ernährer“ geplante Städte
Um zu verstehen, warum es eine neue Art der Stadtplanung braucht, muss man einen Blick in die Vergangenheit werfen. Städte und Dörfer – wie wir sie kennen – sind vornehmlich auf erwerbsarbeitende Männer und ihre Autos ausgelegt. Die Erste, die das bemerkt hat, war die amerikanische Professorin und Architektin Dolores Hayden. In ihrem 1980 erschienenen Essay „What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work”, stellt Hayden folgende These auf: Die Architektur amerikanischer Wohnsiedlungen wurde entschieden von der Vorstellung geprägt, dass Frauen zu Hause der Fürsorgearbeit nachgehen, während ihre Ehemänner außer Haus eine Erwerbsarbeit haben. Entscheidend für die damalige Stadtplanung war also, dass Männer in ihren Autos auf dem effizientesten Wege von ihrem Heim zu ihrem Arbeitsplatz gelangen. Breite Straßen, Autobahnen und Schnellstraßen entstanden. Gleichzeitig wurden die Wohnviertel bewusst von Gewerbegebieten separiert, damit sich die Arbeiter abends und am Wochenende in Ruhe von ihrem Tagewerk erholen konnten.
»Stadtplanung muss ein Abbild der Gesellschaft sein. Unsere Stadtplanung orientiert sich jedoch ausschließlich an einem Ideal – der gesunde, weiße Mann.«
Katja Diehl

Die Wege von Frauen hingegen wurden nicht mitgedacht. Hayden führt aus, dass die Wohnviertel auf die sogenannten „Stay-at-home-moms“ ausgelegt waren, also nicht erwerbstätige Mütter, denen man ein großes Maß an verfügbarer Zeit zusprach. Auf kürzestem Wege zum Einkaufen zu gelangen, war in der Stadtplanung schlicht nicht vorgesehen. Die Einfamilienhaussiedlungen waren zudem oft weit von Gemeinschaftseinrichtungen entfernt. Die Folge: Die Organisation der Kinderbetreuung bedeutet für die Frauen zusätzliche Wege und erhöhten Aufwand.
Der American Dream des frei stehenden Einfamilienhauses, in dem die Frau Ordnung hält und das der Mann nur zum Arbeiten verlässt, setzte sich in den 1950er Jahren schließlich auch in Deutschland durch. Das Zuhause wurde der Mittelpunkt der Familie, der öffentliche Raum wurde darauf ausgelegt, dass erwerbstätige Männer in ihren Autos schnell vorankamen. Die Rechnung dahinter war eine rein wirtschaftliche: Indem sie ihrer Arbeit nachgingen, erwirtschafteten Männer einen messbaren Wert und trugen zum Bruttoinlandsprodukt bei. Durch die Separierung von Wohn- und Gewerbebebauung wurde das Auto als Mittel der Mobilität in den Mittelpunkt gestellt. Der Kauf eines Autos wiederum kurbelte den Konsum und damit das Bruttoinlandsprodukt an – der Kreis schließt sich.
So entwickelten sich Städte, in denen Familien in eigene Baugebieten fernab von Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen und Gemeinschaftseinrichtungen wohnen. Gleichzeitig entstanden Einkaufsviertel und Gewerbegebiete, die nach Ladenschluss beziehungsweise Feierabend wie ausgestorben waren.
Diese Form der Stadtplanung hat auch eine sozioökonomische Dimension. In vielen Städten verschlechtert sich die Wohnlage mit sinkendem Einkommen. Während Menschen mit gutem Einkommen in abgeschiedenen Neubaugebieten im Grünen leben, werden Sozialwohnungen primär an Hauptverkehrsadern oder Randbezirken errichtet. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das Lärm, Abgase und wenig private Freiflächen rund um die Uhr, während besser gestellte Familien ihren Feierabend bei Vogelgezwitscher auf der Terrasse genießen.
Unsichtbare Wege sichtbar machen
Schon 1980 stellte Dolores Hayden fest: Diese Form der Stadtplanung stellt nicht nur das Auto in den Mittelpunkt, sondern ist auch völlig ungeeignet für Frauen, die sowohl Care-Verantwortung tragen als auch erwerbstätig sind. Durch eine Stadtplanung, die den erwerbstätigen Mann ohne Fürsorgeaufgaben in den Mittelpunkt stellt, haben sich für Frauen mit Kindern komplexe Wegeketten entwickelt, die sie nicht nur Geld kosten, sondern auch Zeit und damit Lebensqualität. Hier zeigt sich in der Stadtplanung der Geschlechterkonflikt. Es sind mehrheitlich Frauen, die in Familien die Fürsorgeverantwortung für Kinder, Ältere und Pflegebedürftige übernehmen.
Im Gender Planning müsse man deshalb unsichtbare Wege sichtbar machen, sagt Mobilitätsexpertin Katja Diehl und meint vor allem die Wege, die Menschen mit Care-Verantwortung zurücklegen. Diese Wege sind unbezahlt, bringen also keinen monetären Wert und werden deshalb übersehen. „Wir machen im Durchschnitt drei Wege am Tag, das hat sich nicht verändert. Aber die Wege sind länger geworden“, führt Katja Diehl aus. Morgens ein Kind in die Kita bringen, das andere zur Schule und dann selbst zur Arbeit fahren, unterwegs wichtige Unterlagen in die Post werfen – viele Mütter wissen, wie viel Zeit es kostet, wenn Wohn-, Schul- und Arbeitsort in verschiedenen Vierteln liegen. Auf dem Land umso mehr, denn auch dörfliche Strukturen funktionieren mittlerweile nach der strikten Trennung von Wohnen und Arbeiten.
Es sind also nicht nur fehlende Straßenlaternen, die Orte in einer Stadt gefährlich machen, sondern auch die soziale Struktur dieser Gegenden.
Das Dorf in die Stadt bringen
Das Gender Planning will die Stationen, die Menschen tagtäglich ansteuern, wieder näher zueinander bringen und damit die Lebensqualität aller erhöhen. Eine, die es vormacht, ist die österreichische Stadtplanerin Eva Kail. Kail ist Obersenatsrätin und Expertin für frauengerechtes Planen und Bauen im Amt für strategische Planung in Wien. Wien gilt als Vorreiterin für Gender Planning. Im Nordosten der Stadt entsteht gerade die neue Seestadt Aspern, die als erster Stadtteil komplett nach den Prinzipien des Gender Planning errichtet wird. Kails Leitsatz: „Das Dorf in die Stadt bringen“. Eine Mischnutzung der Fläche soll dies erreichen. In Aspern wird nicht nur Wohnraum für 20.000 Menschen geschaffen, sondern auch ebenso viele Arbeitsplätze. Bildung, Wohnen, Arbeiten und das öffentliche Leben werden nicht mehr voneinander separiert, sondern in einem gemischten Quartier zusammengebracht.
Eva Kail und ihr Team setzen dabei auf Gemeinschaft. So wird sozialer Wohnungsbau derart ausgelegt, dass die Wohnflächen möglichst lange nutzbar bleiben, weil sie großzügig geplant und barrierefrei sind. Gleichzeitig werden Waschräume oder Werkstätten in nachbarschaftlich genutzten Gemeinschaftsräumen untergebracht. So werden Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedenen Hintergrundes in Beziehung zueinander gebracht. Es entsteht nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl, sondern die Nutzung ist aufgrund gegenseitiger Hilfsangebote nachhaltiger und sicherer, auch für Kinder und Ältere.
Auch Parks werden nach diesem Prinzip angelegt: Durch gut ausgebaute Wege, eine gute Beleuchtung, Spiel- und Sitzgelegenheiten sowie Angebote zur körperlichen Betätigung sind sie Freiflächen für Jung und Alt, Männer wie Frauen gleichermaßen attraktiv. Gleichzeitig wird durch die offene Architektur mit niedrigen Hecken und einer guten Einsehbarkeit von der Straße aus dem Sicherheitsbedürfnis Sorge getragen, das vor allem Mädchen und junge Frauen oft umtreibt.
Safer Cities Map zeigt, wo Frauen sich unwohl fühlen
Die Sicherheit von Frauen und Mädchen spielt im Gender Planning eine große Rolle und ist ein
entscheidender Baustein zu einer gleichberechtigten Gesellschaft. Davon ist auch Plan International überzeugt, die deshalb vom 13. Januar bis zum 13. März 2020 die Befragung „Safe in the City? Zur gefühlten Sicherheit von Mädchen und Frauen in deutschen Städten“ durchgeführt haben. Auf interaktiven Karten von Hamburg, Berlin, Köln und München konnten Mädchen und Frauen Pins setzen und so Orte markieren, an denen sie sich besonders sicher oder sehr unwohl fühlen. Laut Alexandra Tschacher, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei Plan International, ging es dabei darum, herauszufinden, welche Erfahrungen Frauen und Mädchen in ihrem Alltag in deutschen Städten machen.
Die Erkenntnisse waren ernüchternd. So berichtet Alexandra Tschacher: „Die Umfrageergebnisse haben uns sehr zu denken gegeben. Von den insgesamt 1.267 gesetzten Ortsmarkierungen wurden 80 Prozent als negativ eingestuft“. Sieht man sich die Pins am Beispiel Hamburg an, wiederholen sich gewisse Merkmale der negativen Markierungen: schlechte Beleuchtung, nicht einsehbare Parks, Bedrohung und Belästigung. „Jede vierte Frau hat sexuelle Belästigung erlebt und jede fünfte gab an, schon mal verfolgt, beschimpft und bedroht worden zu sein.“ Es sind also nicht nur fehlende Straßenlaternen, die Orte in einer Stadt gefährlich machen, sondern auch die soziale Struktur dieser Gegenden.
Hier entfaltet sich die Schwierigkeit, der sich Gender Planning in der Praxis stellen muss. Sarah Peters, zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Hannover, die zuvor Gleichstellungsbeauftragte einer Mittelstadt in Niedersachsen war, sieht die Gefahr, dass in der Stadtentwicklung auch beim Gender Planning nur Checklisten abgearbeitet werden, statt das Problem an der Wurzel anzugehen. Am Beispiel Angsträume von Frauen und Mädchen erklärt Peters: „Wenn ich auf das individuelle Angstempfinden abstelle und sage, ich stelle da Straßenlaternen hin, aber das Viertel bleibt das gleiche, dann habe ich im Endeffekt das Problem nicht gelöst.“
Als Beispiel führt Sarah Peters den Raschplatz hinter dem Hauptbahnhof in Hannover an. Drogenkriminalität sowie Gruppen von betrunkenen oder wohnungslosen Menschen sorgen seit jeher dafür, dass besonders Frauen und junge Leute den Raschplatz eher meiden. Er gilt in Hannover als Problemzone. Um dem Problem zu begegnen, hat die Stadt Hannover das Sicherheitspersonal erhöht, um die unliebsamen Gäste zu vertreiben und so Pendlerinnen, Arbeitnehmern, Familien und Anwohnern eine sichere und angenehme Nutzung des Raschplatzes zu ermöglichen. Peters sieht das kritisch: „Man geht dort nicht auf die Struktur ein, sondern sie schüchtern marginalisierte Personen ein, um den als „normal“ gelabelten Personen ein erhöhtes Sicherheitsgefühl zu geben. Um an der Struktur etwas zu verändern, braucht es Zeit und Geld“.
Inklusive Stadtplanung ist kein Großstadttrend
Genau diese Kosten und den entstehenden Personalaufwand führen Kritiker:innen in Bezug aufs Gender Planning ins Feld. Eva Kail aus Wien hält dagegen und argumentiert, dass die Folgekosten im Gender Planning wesentlich niedriger seien als in der konventionellen Stadtplanung. Aber der Personalaufwand sei durchaus höher, muss auch Kail zugeben. Das stellt manch einen vor die Frage, ob Gender Planning dann nicht eher ein Konzept für Großstädte sei statt für den ländlichen Raum.
Als ehemalige Gleichstellungsbeauftragte einer Mittelstadt kann Sarah Peters die Skepsis nachvollziehen: „In großen Verwaltungen ist die Schlagkraft dafür da, während Gender Planning in kleinen Städten eher weniger mitgedacht wird, weil in den planerischen Häusern die Kapazität für solch eine aufwändige Planung nicht da ist“. Gleichzeitig hält die Expertin fest: „Gender Planning muss auf dem Land funktionieren“.
»In großen Verwaltungen ist die Schlagkraft dafür da, während Gender Planning in kleinen Städten eher -weniger mitgedacht wird.«
Sarah Peters

Gender Planning auf dem Land
Ein Beispiel dafür, dass Gender Planning im ländlichen Raum funktionieren kann, ist der Kinder- und Jugendstadtplan, der gerade in Nienburg/Weser entsteht. Die 31.000 Einwohner:innen starke Mittelstadt verfügt über ein Netzwerk an freien Trägern, die sich im Rahmen des „Communities that care – CTC“-Präventionsprogramms als CTC-Gebietsteam zusammengetan haben. Noch bis zum 31. Oktober 2021 haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Orte im Stadtgebiet zu benennen, an denen sie sich wohl und willkommen fühlen oder die sie eher als unsicher empfinden. Das Prinzip ähnelt also der Safer Cities Map von Plan International.
Laut Tamara Ritter, Leiterin des Begegnungszentrums Sprotte, habe der Kinder- und Jugendstadtplan aber nicht nur zum Ziel, Schutzräume und „Gruselorte“ zu identifizieren, sondern auch, daraus weitere Projekte abzuleiten, die dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sich in ihrer eigenen Stadt sicher und wertgeschätzt fühlen. Deshalb werde der Stadtplan sowohl als Printversion als auch digital zur Verfügung gestellt. Damit geht das Projekt in Nienburg einen Schritt weiter als die Initiative von Plan International. Besonders bemerkenswert: Anders als bei Plan International sind beim CTC-Gebietsteam Nienburg sowohl der Landkreis Nienburg/Weser als auch die Stadt Nienburg als Verwaltungen im Boot. Die gewonnenen Erkenntnisse verbleiben also nicht nur bei freien Trägern, sondern können auch in den Verwaltungen erfasst und für die Zukunft einbezogen werden.
90-Zentimeter- oder 15-Minuten-Stadt – einfach Stadt für alle
Dass Gender Planning also bei weitem nicht nur aufs Geschlecht ausgerichtet ist, sondern auch kindgerechte, barrierefreie und faire Städte schaffen kann, unterstreicht auch die Zukunftsaktivistin Katja Diehl. In ihren Vorträgen und Beratungen verweist sie immer wieder auf die „90-Zentimeter-Stadt“. Diehl fragt Teilnehmende und Zuhörende dann: „Wie ist es, wenn man 90 Zentimeter groß ist und sich durch die Stadt bewegt? Du guckst auf Blech, du atmest die Abgase ein. Als Kleinkind auf dem Laufrad hast du immer einen Erwachsenen hinter dir, der brüllt. Du kannst nichts mehr wagen“. Deshalb fordert Katja Diehl eine #Autokorrektur. Sie ist überzeugt: Nur mit einer intersektionalen Verkehrswende – also einer Stadtentwicklung, die alle Formen von Marginalisierung mitdenkt – können wir zukunftsfähige Städte schaffen und auch die Klimakatastrophe verhindern.
Eine weitere Vision eines Lebensraums, der gemäß Gender Planning gestaltet ist, ist die Idee der 15-Minuten-Stadt, wie sie derzeit in Paris umgesetzt wird. Die Idee: Alle Wege des Alltags sollen in weniger als 15 Minuten bestritten werden können – und zwar mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Möglich wird das durch die Kernidee des Gender Plannings: Gemischte Quartiere, in denen Wohnen, Arbeiten, Essen, Feiern, Bildung, Krankenversorgung und Kultur gleichermaßen stattfindet. Davon würden alle profitieren. —
Hinweis: Dieser Text erschien erstmal in femMit Ausgabe 3.
Bild: AdobeStock/ Svjatoslav