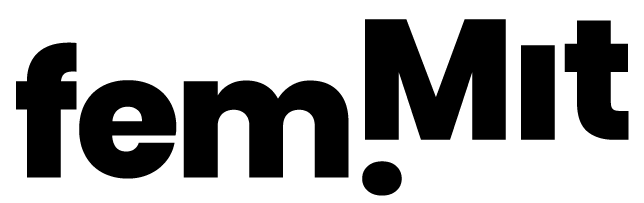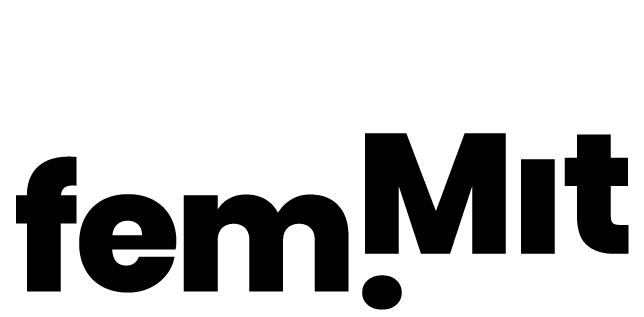Es sollte im Gesundheitswesen um Gerechtigkeit gehen
Gendermedizin ist die geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten. Prof. Dr. med. Sabine Oertelt-Prigione ist Ärztin und Hochschullehrerin an der Radboud-Universität Nijmegen und der Universität Bielefeld. Aktuell baut sie die Arbeitsgruppe Geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld auf. femMit sprach mit ihr über die Bedeutung der Gendermedizin.
Wer profitiert von gendersensibler Medizin?
Alle! Jeder von uns hat in der einen oder anderen Form ein Geschlecht, dem oder der sie sich zuordnet. Und wir haben biologische Grundlagen, die vorhanden sind und sich im Laufe des Lebens auch ändern können, wie zum Beispiel Hormone. Biologische Unterschiede können wir messen und diese Daten können es uns ermöglichen, bessere therapeutische Entscheidungen zu treffen. Letztendlich können also alle Beteiligten im Gesundheitswesen profitieren. Auch diejenigen, die versorgen, also die Ärztinnen und Ärzte.
Was sind die Herausforderungen?
Wir reden immer gerne von individualisierter und personalisierter Medizin. Bisher haben wir jedoch die Unterscheidung in große soziale Gruppen und Kategorien vernachlässigt, die uns potenziell helfen könnten, auf einfachere und kostengünstigere Weise eine Vorauswahl zu treffen, beispielsweise welche Arzneimittel oder welche Therapien funktionieren könnten. Das Geschlecht ist da ein ganz wichtiges Thema. Jenseits der Berücksichtigung biologischer Unterschiede, müssen wir auch sicherstellen, dass allen Menschen die bestmöglichen Zugänge und Behandlungen ermöglicht werden. Das Thema Geschlecht beeinflusst beide Ebenen. Es hat somit eine biomedizinische und eine ethische-moralische Dimension. Es geht letztendlich darum, allen Menschen die beste Behandlung zu ermöglichen. Und jegliches Instrument, was dabei helfen kann, in der Versorgung und Kommunikation, ist willkommen.
In welchen Bereichen spielt gendersensible Medizin eine Rolle?
Bei ganz vielen Erkrankungen sind die Symptome nicht unbedingt gleich verteilt. Selbst wenn wir unsere Medizinbücher lesen, finden wir oft gewisse stereotypische Beschreibungen zu Symptomen, die nur etwa 60 bis 70 Prozent der Patient:innen abdecken. Eine große Anzahl von Patient:innen weist aber vielleicht nicht diese „typischen“ Symptome auf und ihre Erkrankung wird dementsprechend später oder gar nicht diagnostiziert. Manchmal kann das auf große Gruppen zutreffen. Das war historisch so beim Herzinfarkt, bei dem vor allem sehr typische Schmerzen beschrieben wurden, die bei Männern häufiger auftreten. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auch diese ganz typischen Schmerzen haben können – aber eben weniger häufig.
Darüber hinaus sehen wir Unterschiede auch bei neurologischen Erkrankungen. Beim Parkinson zum Beispiel. Die bekannte Einschränkung der Bewegungen wird vor allem bei Männern beschrieben, bei Frauen vor allem ein Zittern der Gliedmaßen. Oder bei Asthma ist das typische Giemen, das hörbare Nebengeräusch beim Atmen, bei Jungen häufiger und bei Mädchen äußert sich die Krankheit oft erstmal als trockener Husten.
„Da führt natürlich eine Unterrepräsentanz von Frauen oder Minderheiten dazu, dass gewisse Fragen nicht gestellt werden, weil Menschen mit gewissen Privilegien das Problem einfach nicht sehen.“
Wir haben 2021 – warum reden wir jetzt erst darüber?
Los ging es schon in den 90ern, damals mit dem Herzinfarkt. Da sahen wir in den Datenbanken der Vereinigten Staaten, dass Frauen, bei denen es aufgrund ihres Alters als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt wurde, dass sie einen Herzinfarkt erleiden, doch welche erlitten. Und diese verliefen wegen der ausbleibenden Diagnose durch die Ärzt:innen und durch die Patient:innen selbst, sogar zum Teil tödlich. Das war ein Wachrütteln für uns alle und hat viel in Bewegung gebracht.
Eine Schwierigkeit ist und war natürlich, dass das Thema lange lediglich als ein feministisch-emanzipatorisches gesehen wurde und man häufig gar nicht die medizinische Bedeutung wahrgenommen hat. Es geht hier um Forschung und die Verbesserung von Behandlung und Diagnose und nicht um das Positionieren von Frauen in Führungspositionen. Wobei wir nicht leugnen können, dass diejenigen, die Forschung betreiben, auch die sind, die Fragen stellen. Da führt natürlich eine Unterrepräsentanz von Frauen oder Minderheiten dazu, dass gewisse Fragen nicht gestellt werden, weil Menschen mit gewissen Privilegien das Problem einfach nicht sehen.
Ändert sich nun auch die Praxis?
Da hat sich in den letzten Jahrzehnten verhältnismäßig wenig verändert. Was aber auch damit zu tun hat, wie sich die Praxis in der Medizin ändert. Vieles wird durch Leitlinien definiert, die nur bei einer sehr guten Datenlage angepasst werden und deren Anpassung mehrere Jahre dauern kann. Wenn wir also keine Studien mit Hunderten oder sogar Tausenden Teilnehmenden haben, in denen wir wirklich belastbare Daten zu Frauen, Männern und eventuell noch anderen Geschlechtern haben – was im Moment noch vollkommen vernachlässigt wird – dann werden wir auch so schnell keine Daten haben, die Eintritt in die Leitlinien haben. Das heißt konkret: ohne Studien keine Leitlinienänderung und keine Änderung in der Praxis.
Wir haben gerade COVID-19-Studien untersucht. Dabei haben wir uns über 4.000 Studien von Anfang 2020 bis Anfang 2021 angeschaut. Im Ergebnis: Ungefähr ein Fünftel aller Studien berücksichtigt bei der Registrierung überhaupt das Geschlecht! Das zeigt, selbst mediale Aufmerksamkeit und steigendes Bewusstsein sind nicht ausreichend, um die Praxis zu verändern.
Das heißt, es muss Regularien geben, an die sich alle halten, und man muss konkret auf Implementierung abzielen. Weil sich sonst das System nicht so schnell verändern wird.
Was kann ich als Patientin oder Patient tun?
Selbst erste Informationen suchen – was sich in Zeiten des Internets manchmal schwierig gestaltet, weil viele Ungenauigkeiten verbreitet werden, die für Nicht-Fachexpert:innen nur schwer zu erkennen sind. Anschließend sollte man sich einen Arzt oder eine Ärztin suchen, der man vertraut. Und offen nachfragen! Denn wenn mir ein:e Patient:in gegenübersitzt, die fragt, ob es Geschlechterunterschiede beim Medikament oder in der Behandlung gibt, dann möchte ich als Mediziner:in auch Antworten darauf haben. Und selbst wenn ich in dem Moment sagen muss, dass das noch nicht untersucht ist, dann bleibt mir das vielleicht hängen und führt hoffentlich beim nächsten Kongress zu einer Fragestellung. —
Hinweis: Dieses Interview erschien erstmals im femMit-Magazin Ausgabe 3.
Foto: Universität Bielefeld
femMit-Magazin bestellen!
-
 femMit Magazin 78,90 €
femMit Magazin 78,90 € -
 femMit Magazin 68,90 €
femMit Magazin 68,90 € -
 femMit Magazin 58,90 €
femMit Magazin 58,90 €