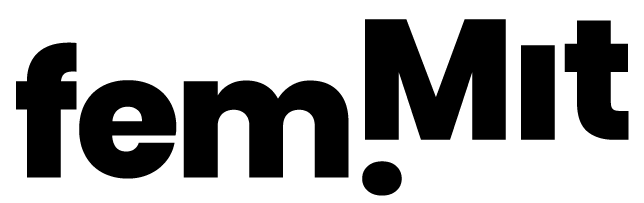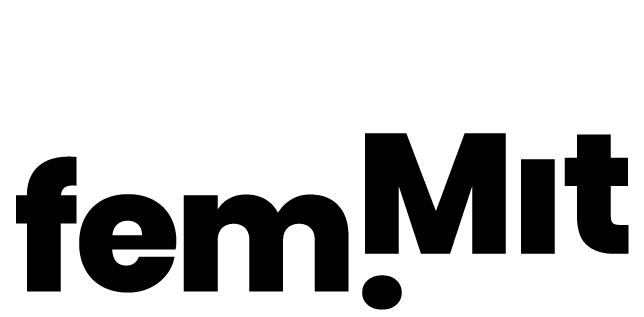Smarte Selbstwirksamkeit
von Martina Cwojdzinski
Wer gestern noch dachte „Ich kann die Welt nicht retten“, kann morgen schon erleben, dass es möglich ist, einen wertvollen Beitrag zu leisten und als Pionier:in des Wandels voranzugehen. Was macht es uns so schwer, unseren umweltfreundlichen Einstellungen umweltbewusste Taten folgen zu lassen?
Wie schaffen wir es, unser Selbstverständnis und unser Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit miteinander zu vereinbaren? Die Umweltpsychologie klärt auf und gibt motivierende Antworten.
„Tu was, tu was, auch deine Hilfe zählt“ – wer die Hörspielkassetten aus den 80ern mit den Geschichten rund um Arborex und den Geheimbund KIM (Karsten, Ingo und Monika) kennt, hat jetzt einen Ohrwurm. Mehr als 35 Jahre ist es her, seit ich mit dem Hörspiel rund um die kleinen Umweltaktivist:innen und ihren Freund, die alte Eiche, eingeschlafen bin. Sie haben mich jahrelang geprägt. Doch bin ich deshalb heute selbst eine Umweltaktivistin? In Gedanken schon, doch im Verhalten viel zu wenig, muss ich eingestehen.
In der Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland 2020“ zeigt das Umweltbundesamt (UBA) die Lücke zwischen den umweltbezogenen Einstellungen und dem individuellen Umweltverhalten von Menschen auf. Mehr als 90 Prozent der für die Studie befragten Personen sagen, dass „dringend Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen“ des Klimawandels ergriffen werden müssten. Gleichzeitig geben 44 Prozent an, dass ihnen „persönlich oft die Möglichkeiten fehlen“ würden, etwas für den Klimaschutz zu tun. Woran liegt es, dass zwischen dem Wissen um unserer aller Situation und dem persönlichen Handeln häufig eine große Lücke klafft?
Unangenehm – für uns selbst und die Umwelt
Diese Lücke wird deutlich, wenn wir uns selbst hinterfragen: Wo verhalte ich mich im Alltag schon nachhaltig? Was würde ich gern besser machen? Die dabei auftretende kognitive Dissonanz beschreibt den für uns unangenehmen Spannungszustand, der in uns den Drang auslöst, gemäß unseren Werten zu handeln. Wenn ich mich selbst reflektiere, merke ich schnell, dass mein persönlich hoher Stellenwert von Nachhaltigkeit nicht dazu passt, dass ich noch in den Urlaub fliege. Um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, erledige ich zu Hause viele Wege mit dem Rad. Mit dieser Ausgleich-Heuristik versuche ich, schlechte Taten mit guten auszugleichen, die jedoch in keinem Verhältnis stehen. Ja, ich kann auch mit der Bahn reisen oder Urlaub in Deutschland buchen, aber das ist so unbequem, und ich habe nicht so schönes Wetter, und überhaupt. Es ist nicht nur der innere Schweinehund, gegen den wir kämpfen. Nein, es sind sogar „Drachen der Untätigkeit“, die sich als psychologische Hürden unserem nachhaltigen Handeln entgegenstellen, sagt der kanadische Umweltpsychologe Robert Gifford. Es gibt zahlreiche Abwehrmechanismen und Verzögerungstaktiken, mit denen wir uns selbst das Leben leichter machen statt nachhaltiger. „Ich würde ja gern, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“ – wir beruhigen damit unser schlechtes Gewissen und schützen uns vor der eigenen Überforderung mit den Folgen des Klimawandels. „So schlimm wird es schon nicht werden“: klassischer Optimismusfehler, Warnungen werden nicht ernst genommen. „In Deutschland ist der CO2-Ausstoß im Vergleich zu den USA und China winzig. Wenn die nichts ändern, lohnt sich unser Engagement gar nicht“ – bei diesem Vergleich mit anderen wird die eigene Verantwortung abgeschoben.
„Es ist eh zu spät. Ich kann die Welt nicht retten“ – diese eindeutige Kapitulation spiegelt den fehlenden Glauben daran wider, selbst einen Unterschied machen zu können.
Egal ob innerer Schweinehund oder Untätigkeitsdrache,
der Gegner sind wir selbst.
„Ich trenne den Müll“ hat im privaten Kreis ebenso eine Wirkung wie ein Unternehmen, das sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach setzt und damit die Nachhaltigkeitsstrategie für erfolgreich umgesetzt erklärt. Beides sind gute Einzelmaßnahmen, allerdings nichts, worauf man sich stolz ausruhen kann, sondern eher begrenztes Handeln. „Es ist eh zu spät. Ich kann die Welt nicht retten“ – diese eindeutige Kapitulation spiegelt den fehlenden Glauben daran wider, selbst einen Unterschied machen zu können. Egal ob innerer Schweinehund oder Untätigkeitsdrache, der Gegner sind wir selbst.
Vom Problembewusstsein zum Umweltverhalten
Wie wir unsere Selbstwirksamkeit stärken und unsere umweltschützende Intention zu tatsächlichem Handeln führen können, weiß die Psychologin Dr. Karen Hamann. In ihrem Handbuch „Psychologie im Umweltschutz“ beschreibt sie das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren auf dem Weg von der persönlichen ökologischen Norm – bestehend aus dem Problembewusstsein („Ist mir das Problem klar?“), dem Verantwortungsgefühl („Fühle ich mich persönlich verantwortlich?“) und der entscheidenden Selbstwirksamkeit („Glaube ich, selbst etwas bewirken zu können?“) – hin zum individuellen Umweltverhalten und den Folgen. Der Abwägungsprozess zwischen sozialen Normen („Was erwartet die Gesellschaft?“) und Kosten und Nutzen des eigenen Verhaltens („Ist es mir das wert?“) spielt ebenso eine wichtige Rolle wie unsere bisherigen Gewohnheiten und Emotionen. Doch das Umdenken beim Thema Nachhaltigkeit liegt nicht nur in jeder Einzelperson, sondern in der Gesellschaft. „Individuelle Verhaltensänderungen sind beschränkt, deshalb braucht es kollektives Engagement. Wir dürfen uns nicht selbst überfordern, uns aber auch nicht auf dem guten Gefühl ausruhen, auf den Coffee-to-go-Becher verzichtet zu haben“, erklärt mir die Expertin im Interview.
„Transformation braucht Menschen in den verschiedensten Rollen als Teil von etwas Größerem. Jeder Mensch kann überlegen: Welche Form des persönlichen Engagements passt zu mir? Was motiviert mich selbst?“
Dr. Karen Hamann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der Universität Leipzig und Vorsitzende der Initiative Psychologie im Umweltschutz (IPU) e. V.
Mit der Frage, ob uns unsere Gefühle, allen voran die Klimaangst, lähmen oder uns zum Handeln motivieren, beschäftigt sich die Psychologin Katharina van Bronswijk. Sie ist Sprecherin des Vereins Psychologists / Psychotherapists for Future e. V. In ihrem Buch „Klima im Kopf“ heißt es: „Bei einigen Menschen motiviert sie tatsächlich zur Handlung, bei manchen ist sie eher lähmend und fördert die Vermeidung.“ So geht es wohl vielen Menschen. Es werden keine Nachrichten mehr geschaut, weil man sich den vielen Krisen und Katastrophen hilflos gegenübersieht. Das ist menschlich. Einen vorsichtigen Umgang mit den Nachrichten empfiehlt deshalb Dr. Karen Hamann. Entscheidend sei zudem, mit welchen Gruppen wir uns umgeben, denn dass man selbst einen Unterschied machen kann, lasse sich am besten durch Feedback in einer Gruppe erfahren. Dafür müsse man allerdings nicht gleich zum Klimakleber werden: „Transformation braucht Menschen in den verschiedensten Rollen als Teil von etwas Größerem. Jeder Mensch kann überlegen: Welche Form des persönlichen Engagements passt zu mir? Was motiviert mich selbst?“, rät Hamann.
Zielgerichtete Nachhaltigkeit fördern
„Es gibt beim Umdenken zu nachhaltigen Verhaltensweisen nicht die eine Methode, die für alle Menschen funktioniert. Wer sich wirklich engagieren will, kann dies mit konkreter Zielsetzung und dem Nachdenken über mögliche Barrieren leichter erreichen“, sagt sie. Wer also sein individuelles smartes Ziel (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch, terminiert) formuliert hat, kann leichter loslegen. Die Motivation kommt dann beim Handeln. „Wir denken häufig, dass wir zuerst motivieren müssen, damit jemand ins Handeln kommt. Heute wissen wir, dass Motivation auch auf Handeln folgen kann. Wenn wir für den Kontextwechsel offen sind und bei nächster Gelegenheit etwas Neues ausprobieren, können wir uns mit der Situation und unseren Visionen besser auseinandersetzen. Positive Erfahrungen und Gefühle motivieren uns und helfen uns dabei, erlebtes nachhaltiges Verhalten zur Routine werden zu lassen“, empfiehlt Hamann.
„Routinen (automatisierte Abläufe von Gewohnheiten) entstehen durch Wiederholung. Je öfter wir etwas tun oder mit einer bestimmten Perspektive auf Themen schauen, umso mehr kann es sich verankern.“
Lena Müller, Psychologists / Psychotherapists for Future e. V.
Die britische Psychologin Phillippa Lally vom University College in London fand heraus, dass es durchschnittlich 66 Tage dauert, ehe wir eine neue Gewohnheit im Alltag etablieren. „Routinen (automatisierte Abläufe von Gewohnheiten) entstehen durch Wiederholung. Je öfter wir etwas tun oder mit einer bestimmten Perspektive auf Themen schauen, umso mehr kann es sich verankern. Wiederholung wiederum lässt sich auf zwei Wegen erreichen: Wir können sie selbst aktiv gestalten, was jedoch herausfordernd und kräftezehrend sein kann. Wesentlich effektiver wäre, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Nachhaltigkeit zum Standard wird – dann passen wir uns automatisch an, weil es einfacher, günstiger und attraktiver wird oder aber wir uns gar nicht mehr entscheiden müssen, weil die schädlichen Alternativen wegfallen. Und genau dafür braucht es gesellschaftliches Engagement, damit entsprechende politische Entscheidungen getroffen werden“, erklärt Lena Müller von den Psychologists / Psychotherapists for Future e. V.
Am Ende ihres Buches schreibt Katharina van Bronswijk: „Immer, wenn wir selbst einen Schritt in die richtige Richtung gehen, werden wir sozusagen Pionier:innen des Wandels. Pionier:innen des Wandels leben anderen Menschen vor, wie die Utopie von einer schöneren Zukunft aussehen könnte.“ —
Hinweis: Dieser Text erschien in femMit-Magazin Ausgabe 6 – Die ganze Ausgabe bestellen.
Bild: AdobeStock/doidam10