Traut euch!
Wie die private Kunstinitiative FATart die Schweizer Kunstszene in Aufruhr versetzt und die Co-Gründerin und Künstlerin Ursina Gabriela Roesch partout nicht gedenkt, damit aufzuhören. Auch nicht, den Frauen den Spiegel vorzuhalten und sie zu ermutigen, ihren Weg zu gehen.
Text: Indrani Das Schmid
Schaffhausen, vor ein paar Tagen flogen noch Schneebälle durch die Luft, und wenn einer besonderen Schwung hatte, klatschte er an die Mauern des ehrwürdigen Munots, der geliebten Burg dieses Schweizer Städtchens am Rhein, kurz vor dem Rheinfall, zwischen den Hegauer Vulkanen und dem deutschen Ufer des Bodensees gelegen. Idyllisch ist es hier. „Ja, sehr idyllisch“, sagt Ursina Gabriela Roesch. „Fast zu idyllisch“.
Sie klingt durch das Telefon so, als ob sich ihre Lachfältchen um ihre Augen vertiefen. Man sieht ihre grünen Augen regelrecht schelmisch blitzen. So wie sie immer diesen Ausdruck zwischen genauer Beobachtung und Belustigung annehmen, wenn Ursina Roesch in ihrem Element ist. Das fiel mir als Kulturjournalistin bereits bei unserem ersten Zusammentreffen auf. Als sie und FATart Co-Gründer Mark Damon Harvey die Türen zu ersten FATart Fair, zur ersten FATart-Kunstmesse, eröffneten.
Das war an einem sehr sonnigen, sehr warmen Tag im September 2018. An dem in der Rhybadi gegenüber die Menschen ins kalte Wasser des Rheins sprangen und diese Künstler:innen in eine für sie ungewisse Zukunft.
Eine Zukunft namens FATart Fair
Eine Zukunft, die FATart Fair hieß. Oder die Kunstmesse für Künstlerinnen und Produzentinnen – für die Künstlerin Ursina Roesch die logische Weiterführung ihres Künstler:innen-Stammtisches (Femme Artist Table), den sie bereits 2016 in Zürich initiierte. FAT steht für das Thema Frauen und Minderheiten in der Kunstwelt. Minderheiten wie sie Mark Damon Harvey präsentiert. Wenn er spricht, wird es in den Reihen still. Nicht nur wegen seines charmanten amerikanisch-schaffhausischen Schweizerdeutschs, sondern weil er in seiner ruhigen Art auf einen anderen blinden Fleck aufmerksam macht. Den der Minderheiten, in seinem Fall die Kunst schwarzer Amerikaner. Ohne Vorwurf, ohne Pathos. Empathisch baut er Brücken.
Zwischen der Perspektive seines Publikums und seiner Auffassung. „Man findet immer einen gemeinsamen Punkt, an dem man starten kann“, sagt der Experte für Intersektionalität, der auch in Gefängnissen unterrichtete.
Doch mit der Zeit reichte es den beiden nicht, über all das zu reden, was man verändern müsste, hier in der Schweiz. Um die Frauen und Angehörigen von Minderheiten sichtbarer zu machen. Hier in dem Land der direkten Demokratie. Das Land, das sich in Fragen von Geschlechter-Demokratie und gleicher Teilhabe am Staat für alle seine Bewohner:innen zutiefst undemokratisch verhält.
Die Schweiz ist reich. Gut ausgebildet zu sein, ist normal. Doch schon bei der Frage nach Infrastrukturen, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, wie Ganztagsschulen, Kindergärten oder Horte, kann man sehr überrascht werden.
„Wir werden marginalisiert!“
„Wir Frauen werden in diesem Land marginalisiert.“ Sicher? Sicher! Marginalisiert im Sinne, dass Frauen und Minderheiten es schwer gemacht wird, die gleichen Chancen zu erhalten wie Männer. Wie die weißen Männern, genauer gesagt. Ja, das tue weh, das höre niemand gerne. Doch das sei ein Fakt. Allein die Tatsache, dass Künstler:innen es so viel schwerer haben, Zugang zur Kunstbranche zu erhalten, als die Männer, sei ein Indiz. Wobei es auch hier kein Schwarz-Weiß, kein Gut-Böse gebe. Die Ursachen lägen viel tiefer, sagt Ursina Roesch. Sie liegen zum einen in den Details der Fragen, die die Genderforschung nur allzu gut kenne. Überall, nicht nur in der Schweiz. Wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine weibliche Biografie anders ist als eine männliche oder gilt die männliche immer noch als „Norm“? Wie ist der Zugang zu den Ausbildungsstätten? Zur Arbeit? Die Schweiz ist reich. Gut ausgebildet zu sein, ist normal. Doch schon bei der Frage nach Infrastrukturen, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, wie Ganztagsschulen, Kindergärten oder Horte, kann man sehr überrascht werden. Während die französischsprachige Westschweiz – die Romandie – über ein recht gut ausgebautes Betreuungsnetz verfügt, gilt das für die Deutschschweiz ausserhalb der großen Städte Zürich, Bern und Basel nur eingeschränkt bis gar nicht.
Kinder werden hier als „Privatsache“ angesehen, um die man sich alleine zu kümmern habe. Was im schroffen Gegensatz zur französischen Auffassung stehe: Hier seien die Kinder der Reichtum der Nation. Darum sehe sich der Staat hier in der Pflicht. Die Romandie hat versucht, diesen Gedanken mit dem zweiten Schweizer Grundprinzip – der Staat soll sich so wenig wie möglich einmischen – zu verbinden. Die Folge: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist besser gelungen als in der Deutschschweiz. Doch gilt das auch für die kreativen Berufe?

Brophy, Bassetti, Simmendinger, von Scarpatetti, Foto: ©FATart 
Maria Martin, Margrit Schlumpf-Portmann (Skulpturen), Foto: ©FATart 
„Living Fabrics“ interaktive Performance Workshop von Nesa Gschwend, Foto: ©FATart 
Eliane Zinner, Foto: ©FATart
Hmm, sie könne nur auf eine Studie des NDR verweisen, sagt die Künstlerin Ursina Roesch, genauer auf den Film „Warum sind Kunstwerke von Frauen weniger wert?“ aus dem Jahre 2020 von Simone Horst und Kira Gantner, die akribisch nachgezeichnet haben, in welchem Teufelskreis sich Künstlerinnen befinden, wenn sie denn als Künstlerinnen leben wollen. Inklusive eindringlicher Zahlen und Fakten. Demzufolge wird der Marktpreis von Galerien bestimmt und zwar auf die Formel Breite × Höhe eines Werkes × „Wert eines Kunstschaffenden“, aka Bekanntheitsgrad.
Doch gerade bei dieser Größe beißt sich die Katze in den Schwanz. Jedenfalls für die Frauen. Denn bekannt wird man durch die Teilnahme an Gruppen-Ausstellungen, besser über Einzelausstellungen, noch besser über Ehrungen durch Museen und Ausstellungshäuser, über den Preis, den Sammler:innen auf Kunstmessen und Auktionen bereit sind für Werke zu zahlen. Doch was heißt das, wenn laut den Recherchen des NDR, Einzelausstellungen zu 80 % an männliche Künstler vergeben werden und nur zu 20 % Künstlerinnen einzeln ausstellen können. Obwohl mehrere Tests ergeben haben, dass die Zuschauer:innen nicht zwischen „männlichen“ und „weiblichen“ Werken unterscheiden, wenn sie die Namen der Urheber:innen nicht kennen. Was bedeutet es, wenn den Frauen unverblümt mitgeteilt wird, dass Kinder ein Imageschaden für sie seien. Also für sie, die Mütter, nicht für die Väter. Während männliche Künstler im Durchschnitt 3 Kinder haben, haben Künstlerinnen nur 0,3.
Das Stockholmsyndrom der Frauen
„Unglaublich!“, schnauft Ursina Roesch durch die Nase. Und warum? Wenn sie ihre Enkelin beobachtet, wie sie gerade das Laufen entdeckt, dann frage sie sich schon, warum es für Frauen immer noch so schwierig sei, den eigenen Weg zu finden. Es für sie nicht laufe. Nicht in Deutschland, nicht in der Schweiz. Schon gar nicht hier, in dem Land, das vor gerade mal 50 Jahren den Frauen das Stimmrecht gab, sagt die gebürtige Zürcherin, die im ländlichen Aargau aufgewachsen ist. Viele Frauen leiden an einer Art „Stockholmsyndrom“, wie die Konzeptkünstlerin trocken den Versuch vieler Frauen, in den männlichen Strukturen ihren Platz zu finden, nennt. „Über Gender zu reden, ist en vogue. Aber konkrete Änderungen herbeizuführen, das ist eine andere Geschichte.“ Und daran seien nicht nur die Männer schuld, die um ihre Deutungshoheiten, Netzwerke und Pfründe bangen, sondern auch die Frauen selber. So sehe sie zum Beispiel nicht, dass sich Kurator:innen, die Museumsdirekto:rinnen, Galerist:innen sich wirklich bemühen, Künstlerinnen zu fördern. Zu groß sei die Angst, negativ aufzufallen, anzuecken. In einem Land, durch das man in knapp drei Stunden durchfahren kann. Und das Direktheit, im Diskurs, in einer Konfrontation, nicht in seiner DNA hat.
FATart Fair: Die erste Kunstmesse, auf der die Künstlerinnen auch gleichzeitig ihre eigenen Verkäuferinnen sind. Künstlerinnen als Unternehmerinnen.
Selbst ist die Frau!
Das wollte Ursina Roesch nicht hinnehmen. Wenn niemand die Initiative ergreife, dann mache sie es eben selbst. FATart Fair entstand: Die erste Kunstmesse, auf der die Künstlerinnen auch gleichzeitig ihre eigenen Verkäuferinnen sind. Künstlerinnen als Unternehmerinnen. „Ja, das ist für viele Kreative eine Herausforderung“, gibt Ursina Roesch zu. Darum gebe es im Vorfeld der Messe für die Ausstellenden Kurse zu Themen wie „Wie vermarkte ich meine Kunst, wie setze ich die Preise fest?“ Nicht jeder Künstlerin sei das Verhandeln über den Preis der eigenen Werke in die Wiege gelegt worden. „Mir schon!“ Ein tiefes Lachen dringt durch die Telefonleitung. Als Tochter eines Elternpaares, das sich Anfang der 50er Jahre eine alte Kirche im ländlichen Aargau kaufte, um daraus ein Heim für betagte Künstler:innen zu machen, beobachtete die kleine Ursina ihre Umgebung sehr genau. Und das was sie sah, prägt sie bis heute. Ihre Eltern, die beide zwar einen bürgerlichen Beruf hatten, aber im Tiefsten ihres Wesen Künstler:in waren, in der Musik wie an der Leinwand. Die offene, herzliche Atmosphäre, mit der sie ihre Gäste empfingen. Die Kunst, die diese mitbrachten. All das gefiel ihr sehr gut. Nicht jedoch das Korsett, das sie auch beobachtete. Die Schule, ein System, das ihren Geist rebellisch werden ließ und die Veränderung der Mutter. Ihre Mutter, die zu den regelmäßig eintrudelnden Gesprächseinladungen der Lehrer mit geradem Rücken, elegantem Kleid, rotem Lippenstift und Stöckelschuhen ging, war das Idol der kleinen Ursina. Obwohl beide das Kunstzentrum aufbauten, der Vater die Netzwerke und Strategien pflegte, die Mutter mit ihrem Know-how als Hotelfachfrau sich um die organisatorischen Belange kümmerte, obwohl beide ihren Anteil daran hatten, dass es bis heute ein kulturelles Aushängeschild der Gegend ist, stand vor allem der Vater in der Sonne des Ruhms. „Meine Mutter wurde nicht gesehen“. Nicht ihr Anteil an diesem, für die damalige Zeit ungewöhnlichen Projekt, nicht ihre Fähigkeiten als Pianistin, nicht ihr Anteil als Familienfrau. Die Folge: Mit 40 Jahren schmiss ihre Mutter ihre Stöckelschuhe in die eine Ecke, die eleganten Kleider in die andere und den roten Lippenstift würdigte sie bis zu ihrem Lebensende keines Blickes mehr. „Sie verweigerte sich, sich streikte.“, sagte Ursina und fügte leise hinzu: „so schade.“ Ursina war als junges Mädchen von der Verwandlung ihrer Mutter so geschockt und irritiert, dass sie begann, sich nach anderen weiblichen Vorbildern umzusehen, in ihrer Umgebung, im Kunstheim.
„Nichts! Wenn mal eine Künstlerin da war, war das eine große Ausnahme!“ Sie klingt fassungslos. „Wo waren sie denn, die Künstlerinnen? Nicht da. Nicht existent!“. Das wollte sie für sich nicht hinnehmen und beschloss, das Beste in sich selber zu suchen. Und frei zu denken. Etwas, was in der Schweiz bis heute mit Risiken verbunden ist.

Schlumpf Portmann_Belvedere_Schindler_Pöpel Foto: ©FATart 
Zuschauer*innen Performance von Annkathrin Pöpel Foto: ©FATart 
Aufbau Margrit Schlumpf-Portmann. Foto: ©FATart
Ursina ging nach Paris, auf die dortige Modeschule. Ließ keine Vorlesung der feministischen Philosophin und Autorin Hélène Cixous aus und tauchte in das quirlige Pariser Künstler:innenleben ein. Ein paar Abschlüsse, Stammkundinnen und Jahre in dieser Szene später, ging sie wieder zurück in die Schweiz. Als Kreative, die alles, was sie interessierte, aufsog, damit spielte und für sich umwandelte. Sei es als Konzeptkünstlerin, die zwischen Fotografie, Wort und Mode spielt, als Unternehmerin, die ihrer Ruder-Passion mit einer eigenen Ruderschule nachging und Medaillen für die Schweiz bei internationalen Wettkämpfen wie 2019 an der World Rowing Coastal Championships in Hongkong gewann. Oder als Ehefrau und Mutter, die gemeinsam mit ihrem Partner zwar beschloss, das Experiment der bürgerlichen Ehe zugunsten einer tiefen Freundschaft sein zu lassen, aber ihren gemeinsamen Sohn so aufzog, dass er unvoreingenommen das Lebensmodell seiner freigeistigen Eltern beobachten konnte und jetzt als Kunst-und Musik-Vermittler arbeitet.
„Ihn zu beobachten, war spanned“, sagt Ursina Roesch. Auch, wie sich die jungen Männer von Anfang an vernetzten und sich in ihren Visionen unterstützen. Vernetzen! Sich gegenseitig unterstützen! Seinen Marktpreis selber bestimmen! Es wurde Zeit für Veränderung! Zeit für die FATart Fair.
„Es wird immer noch zu viel
geredet und zu wenig getan.“
Ursina Roesch
Der unangenehme Spiegel
Waren es auf der ersten FATart Fair 50 Frauen, die ausstellten, gibt es für die diesjährige bereits Wartelisten, obwohl der Call noch gar nicht beendet ist. Es spricht sich herum, dass auf dieser in Europa einzigartigen Kunstmesse Kunst von bekannten und weniger bekannten Protagonistinnen zu sehen ist. Das reinste Schatzkästchen-Feeling für Kurator:innen und Galerist:innen, die letztes Jahr sogar aus Mailand nach Schaffhausen, dem idyllisch verschlafenen Städtchen am Rhein anreisten.
Doch das reicht dem Kreativ-Team um Ursina Roesch, Mark Damon Harvey und der kuratorischen Leiterin Pauline Della Bianca nicht. Auch nicht, dass sie die Sprachgrenzen überwunden haben und man in den Ausstellungshallen ein fröhliches Durcheinander aus Deutsch, Französisch und Italienisch hört. Selbst die über 300 Künstlerinnen, die durch die FATart Fair vermittelt wurden oder Aufträge bekamen, bringt sie nicht dazu, sich jetzt zurückzulehnen.
„Es wird immer noch zu viel geredet und zu wenig getan“, stellt Ursina Roesch fest. Auch wenn nach ihrer ersten Kunstmesse die beiden Medien Swissinfo und Tagesanzeiger, anfingen, die Einzelausstellungen von Frauen in den Schweizer Museen zu zählen. Und völlig fassungslos fragten: „Wo sind die Frauen?“
Angesichts einer durchschnittlichen Quote von rd. 26 % verständlich, wobei vor allem die kleineren Museen mehr Künstlerinnen zeigten als die großen Kunsthäuser wie das Kunsthaus Zürich oder die Fondation Beyeler Basel. Da lag der Anteil der Ausstellungen von weiblichen Kreativen bei mageren 15 %. Diese Zahlen führten zu Protesten und unangenehmen Fragen an die Verantwortlichen.
Jetzt, zwei Jahre später, sieht es quotenmäßig nicht viel besser aus. Aber mittlerweile sind Gespräche im Gange. So werden Ursina Roesch und ihr Team immer wieder eingeladen, um ihre Sicht darzulegen und auch an neuen Konzepten mitzuarbeiten. Kleine Schritte.
Energie, um weiterhin zu verändern
Dass ihre privat finanzierte Kunstmesse und weitere Ausstellungen nun kräftig gefördert werden, glaubt die Gründerin noch nicht. Dazu seien sie zu unangepasst, zu eigen. Aber ans Aufhören denkt sie nicht. Trotz Corona, trotz ungewissem Ausstellungsort, trotz unsicherer Finanzierung. „Wenn ich mir ansehe, was wir in den letzten zwei Jahren erreicht haben, welche Diskussionen wir angestoßen haben, durchfließt mich Energie!“
Energie, mit der sie am liebsten ihre Künstlerinnen überschütten würde, um sie aus der Angst, anzuecken, Angst, nicht gut genug zu sein, herauszuholen. Und gemeinsam endlich das einzufordern, was ihnen – den Frauen – laut Ursina Roesch bis heute in der Schweiz vorenthalten wird. Die gleichberechtigte Teilhabe an Entscheidungen und ökonomischer Macht. —
Der nächste Call für die FATart Fair #4 in Schaffhausen läuft seit 8. März 2021.
Hinweis: Dieser Text erschien erstmals im femMit Magazin 1/2021
Foto: Irem Güngez
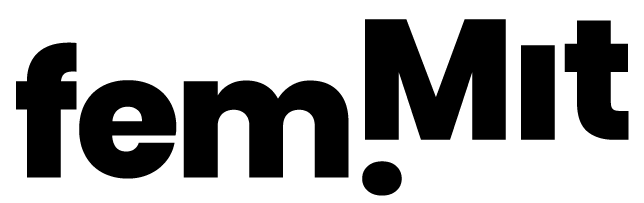
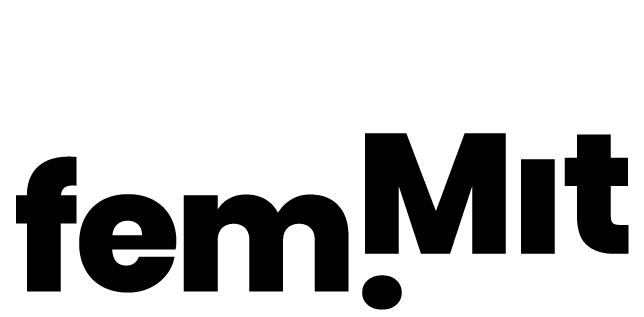


Ursina Roesch – Co-Gründerin der FATart – ein Porträt im femMit Magazin | SWONET
5 Jahren ago[…] Der Artikel im femMit Magazin […]
Maria
5 Jahren agoGuten Tag! Weiter gehen können ist für jeder Künstler notwendig! Jeder neue Kontakt mit künstler zu künstler und Publikum bringt neue Enegien! Meine Grosse Atelier ist voll Werke! Ich werde gerne teilnehmen aber wie?? Transport und Hotel in Schafhauen kostet.! Habe niemand welche.mir helfen werde ??
Wie weiter?? Corona Virus Strategien haben viele kunstschafende blockiert !
Jetzt ist zusamenhalt sehr wichtig !
Bravo für eure sehr wichtige idee ! Beste Grüsse Maria Dundakova