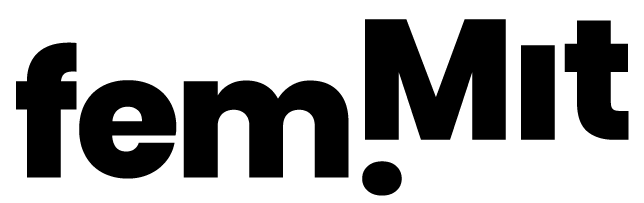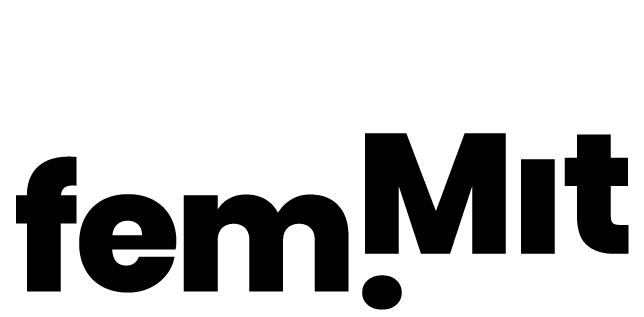Es war alles ein bisschen schwieriger
Am 1. Oktober 1964, als Dr. Ursula Bühler noch Petersen mit Nachnamen hieß, wurde sie mit 30 Jahren die jüngste Chefärztin für Anästhesie in Deutschland. Über ihren Lebensweg dorthin und weiter, von Hongkong über Tokio nach Hamburg, sowie die 35 spannenden Berufsjahre danach schreibt für femMit ihr ältester Sohn.
Text: Götz Bühler
Ursprünglich wollte Ursula Bühler, die feine Dame mit der Perlenkette, die der Autor dieses Interviews meistens Mami nennt, Chirurgin werden. Schon ihr Vater träumte von diesem Beruf, doch an ein Studium war finanziell nicht zu denken. Als Kaufmann verschlug es ihn nach Hongkong, bald mit Frau und zwei Töchtern. „Ich weiß gar nicht, ob das nicht infundiert hat“, meint die jüngere Tochter heute, mit 87. „Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich in China mit vier oder fünf Jahren immer zu den Angestellten geschickt wurde, wenn sie krank waren. Dann musste ich Händchen halten und sie streicheln – und am nächsten Tag waren sie wieder gesund. Dieses Menschliche, das gefiel mir so sehr. Es hatte natürlich noch gar nichts richtig mit Medizin zu tun. Es war einfach so ein Gefühl.“
Das Gefühl blieb, auch über die Kriegsjahre hinweg, die die Familie in Japan überlebte. Zurück im Nachkriegsdeutschland fasste sie 1952 den Entschluss, Medizin zu studieren. „Als der Brief kam, dass ich zum Studium zugelassen wurde, habe ich vor Freude geschrien und bin meiner Mutter um den Hals gefallen“, erinnert sie sich. „Ich hatte nicht damit gerechnet, angenommen zu werden. Es wurden ja bevorzugt ,Spätheimkehrer’ angenommen. Und sowieso eher Männer.“ Das Studium war abenteuerlich.

Statt Laboren gab es Nissenhütten im teilweise ausgebombten Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg – im Winter schlecht geheizt, im Sommer nicht klimatisiert. „Neulich fragte mich jemand, ob ich denn nie zum Tanzen oder Kaffeetrinken gegangen wäre. Und ich sagte: Das gab es gar nicht. Erstens hatten wir kein Geld. Meine Eltern hatten im Krieg alles verloren und haben trotzdem mein Studium bezahlt. Klaglos. Aber wenn ich Fachbücher brauchte, die es damals oft nur in kleinen Auflagen gab und die deshalb wahnsinnig teuer waren, musste ich die selbst bezahlen. Ich musste immer etwas nebenbei verdienen, habe bei Empfängen ausgeholfen oder bei Beiersdorf am Fließband gesessen. Zweitens gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, dass man Tanzen ging. Da kannte man höchstens den Tanztee im Studentenclub. Das war das höchste der Gefühle. Ich habe mich damals immer nur um meine Arbeit gekümmert.“
Heute, fast siebzig Jahre später, staunt sie eher über die damaligen Umstände, als zu klagen. Doch einige Verletzungen schmerzen sie noch heute. Ein Dermatologieprofessor beschimpfte sie coram publico in einer Vorlesung. Sie hatte zwar das komplizierte Krankheitsbild des Patienten richtig erkannt und erklärt, war aber nicht in der Lage, ihn aufgrund seines Akzents als Ostpreußen zu identifizieren. „Ich konnte ihm gar nicht sagen, dass ich erst vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen war und nur Hochdeutsch kannte. Er hat mich nicht zu Wort kommen lassen und immer nur geschimpft. Über Geschichte und Tradition und was ich mir denn einbilde, alles zu vergessen. Das war für mich eigentlich die schlimmste Prozedur, weil der Hörsaal voll war und ich da unten mit dem Patienten vor ungefähr 150 Leuten stand. Der Professor war aber auch so ganz widerlich und hatte, glaube ich, ohnehin etwas gegen Frauen.“
„Er schrieb dann handschriftlich oben auf den Ergebnisbogen: ‚Jetzt ist sie tadellos, aber wie sie sich in Zukunft entwickelt, ist nicht zu sagen.'“
Ursula Bühler
Ein andermal verdarb ihr ein Anatomie-Professor ein Fulbright-Stipendium. „Der war so gehässig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich hatte eine Eins bei ihm und auch in den Prüfungen für das Stipendium vorher. Er schrieb dann handschriftlich oben auf den Ergebnisbogen: „Jetzt ist sie tadellos, aber wie sie sich in Zukunft entwickelt, ist nicht zu sagen.“ Und damit war das gelaufen – ich bekam das Stipendium nicht. Das war eben so: Man war abhängig von den Professoren und völlig hilflos, man konnte sich nicht wehren. Und ich war ja so demütig erzogen und da kam das ohnehin gar nicht infrage. Es war alles ein bisschen schwieriger.“
Die Chirurgie war immer noch ihr Traumfach, also ging die damals 24-Jährige nach Promotion und Approbation in Hamburg nach Hagen. „Ich wohnte dort im Krankenhaus und war die einzige Assistentin für alle Fachärzte – Chirurgie, Innere, Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und HNO. Und glaubst du, da kam einer der Chefs mal nachts? Völlig unmöglich. Die haben nur am Telefon gesagt: „Machen sie man.“ Da habe ich enorm viel in der Praxis gelernt. Hagen hatte vielleicht 120 Betten, da gab es jede Nacht viel zu tun. Der Nachtdienst und die Wochenenddienste waren unbezahlt, das gab es gar nicht anders. Ich habe ohnehin nicht das Gleiche verdient wie meine männlichen Kollegen, auch später im Beruf nicht. Doch in Hagen war ich zum ersten Mal stark und habe gesagt: „Ich will ein ganz normales Assistentengehalt haben“. Und ich bekam es. Und als ich dann nach einem Jahr sagte: „Jetzt bin ich die ganze Nacht auf den Beinen gewesen und habe auch das Wochenende durchgearbeitet, jetzt will ich auch den Nachtdienst bezahlt haben“, sind die Chefs fast umgefallen. Sie lacht kurz auf und ihre Augen funkeln, als wäre sie noch immer überrascht und glücklich über ihre damals noch untypische Courage.
Hagen war auch aus einem anderen Grund wichtig, sogar zukunftsweisend. „Ich wollte immer noch Chirurgin werden und hatte da einen Chef, der mir ehrlich sagte: „Sie sind fantastisch, aber sie werden in Deutschland niemals etwas erreichen, weil die Männer ihnen beruflich keine Chance geben werden.“ Er empfahl ihr die Anästhesie, die als Fachrichtung in Deutschland noch jung war – am „27. Mai 1953 absolvierte der erste bundesdeutsche Arzt seine Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesie“, wie Wikipedia weiß – und daher auch Chancen für Frauen bot. Sie nahm die Empfehlung dankend an. „Als ich am 1. Oktober 1964 im Albertinen Krankenhaus (in Hamburg-Schnelsen) als Chefärztin anfing, war ich eigentlich nicht eingeplant. Nur weil die anderen Chefärzte aus größeren Hamburger Krankenhäusern kamen und darauf bestanden, dass eine Anästhesie da sein musste, wurde ich angeheuert.“
Das Albertinen Krankenhaus war ein diakonisches Krankenhaus und daher, wie sie sagt, „sehr sparsam“. Die Narkosen hatten zuvor Krankenschwestern gemacht. „Allerdings gab es zwei Schwestern mit Anästhesie-Fachausbildung, das war sehr gut, denn wir hatten ja zu Anfang drei oder vier OPs und nur eine Anästhesistin. Das war ich. Und dann mussten die Schwestern natürlich auch weiterhin Narkosen machen. Ich musste also jede Narkose anfangen und anschließend übergeben.“ Problematisch war auch, dass das Krankenhaus fast fertig gebaut war, in den Plänen aber kein Platz für eine Anästhesie vorgesehen war. „Ich bekam also nur ein kleines Arbeitszimmer, das ursprünglich als Aufenthaltsraum für eine Sekretärin gedacht war. Die Kollegen hatten alle große Chefarzträume und Sekretariate und natürlich eine eigene Sekretärin. Ich habe erst nach acht Jahren, als das Haus 1972 erweitert wurde, eine Sekretärin und ein Chefarztsekretariat gekriegt. Vorher musste ich immer antichambrieren, also bei dem Sekretariat der Chirurgen bitten, ob die mir mal was schreiben oder dokumentieren. Das war natürlich alles sehr unangenehm.“
„Die Leitung konnte sich nicht vorstellen,
dass man Ärztin und Mutter gleichzeitig sein kann. Schwangerschaftsurlaub?
Unvorstellbar.“
Ursula Bühler
Als sie anfing, war Frau Dr. Petersen mit 30 die jüngste Chefärztin der Anästhesie in Deutschland und die einzige Chefärztin an ihrem Haus. „Immerhin gab es Kolleginnen in der Gynäkologie und der Geburtshilfe. Später gab es auch eine Ärztin in der Orthopädie. Als die ein Kind bekam, war die Krankenhausleitung gar nicht darauf eingerichtet. Sie wollten sie sofort entlassen und ihr keinen Mutterschaftsurlaub oder Geld zugestehen. Da hat sie gekämpft und weil das kurz vor meiner ersten Schwangerschaft passierte, hatte ich es einfacher und konnte davon profitieren. Die Leitung konnte sich nicht vorstellen, dass man Ärztin und Mutter gleichzeitig sein kann. Schwangerschaftsurlaub? Unvorstellbar. Ich hatte zwar anfangs eine Vertretung, einen sehr aparten Herrn, der seine Sommerreifen in meinem Büro stapelte, wo er auch schlief. Allerdings fand der wohl bald eine bessere Anstellung und ich musste wieder arbeiten.“
Die anderen Chefärzte am Albertinen Krankenhaus waren alle mindestens zehn Jahre älter, doch die junge Kollegin wurde gut aufgenommen. Meistens. „Wir hatten eigentlich ein sehr teamartiges Gefühl“, sagt sie. „Obwohl: Team sagte man damals ja noch nicht. Wir hatten ein freundliches Gefühl miteinander.“ Dass ein oder zwei der männlichen Chefs sie nicht ernst nahmen, sie arrogant behandelten und von neuen Erkenntnissen ausschlossen, um sie anschließend damit zu blamieren, erwähnt sie erst Wochen später auf Nachfrage. „Mich hat das enorm wütend gemacht. Aber was hätte ich tun sollen? Mich beschweren? Bei wem denn? Ich hatte gelernt, dass ich mich als Frau immer aufs Neue beweisen und behaupten muss. Ich kannte es eben anders.“
Anfangs wohnte sie im Krankenhaus, ganz oben im Dachgeschoss. „Nach der Röntgen-Visite kamen alle Chefs zu mir und tranken Kaffee. Dabei wurde auf dem kleinen Dienstweg alles Mögliche erledigt, was viel einfacher war als dieser Behördenkram jetzt, mit Papieren und E-Mails hierhin und dahin schicken.“ Noch enger als zu den anderen Chefs war die Beziehung zu ihrem eigenen Team. Mit einigen ihrer Krankenpflegerinnen hält sie bis heute Kontakt, über zwanzig Jahre nach ihrer Pensionierung. „Eine meiner Oberschwestern hat gerade gestern wieder angerufen. Wir haben uns daran erinnert, wie es war, als wir unsere ersten Beatmungsgeräte bekamen. Die Patienten wurden beatmet und es stand nur eine Schwester für die ganze Station zur Verfügung. Die Tür musste immer offen stehen, damit sie die Patienten beobachten konnte. Heute ist jedes Gerät, das am Patienten angeschlossen ist, mit einem Signal bestückt und wenn irgendetwas nicht normal läuft, die Atmung oder die Infusion oder was weiß ich, dann gibt es Alarm – das gab es früher überhaupt nicht. Wir hatten auch keine zentralen Zugänge, wir hatten nur unsere normalen Zugänge am Arm für die Infusionen und nicht genug Personal. In den meisten Fällen ist es gut gegangen, weil die Schwestern sehr, sehr vorsichtig waren.“
Noch bis vor einigen Jahren hatte die bald 88-Jährige „ihre“ medizinischen Fachmagazine abonniert. Ihr Interesse an dem Beruf, den sie ihr Leben lang leidenschaftlich ausgeübt hat, ist ungemindert. „Ich war 35 Jahre lang Chefärztin und in diesem Zeitraum war die Entwicklung enorm in der Medizin. Was sich da alles technisch, chirurgisch, medizinisch entwickelt hat, war ja ganz, ganz gewaltig.“ Sie macht eine Kunstpause. „Und in manchen Dingen waren die Frauen eben genauso gut wie die Männer. Wenn nicht besser, weil sie fleißiger waren.“ Ihre drei Enkeltöchter sollen es einmal einfacher haben, in einer gerechteren Welt leben und arbeiten – und Karriere machen? „Ich habe keine Karriere gemacht“, sagt sie, ebenso ein maßloses Understatement wie dieser Nachsatz: „Ich habe nur Glück gehabt, weil ich ein Ziel hatte.“ —
Hinweis: Dieser Text erschien in femMit-Magazin Ausgabe 3
Foto: privat